Die Europäische Union war einst ein Kämpfer für den Klimaschutz. Gesetzespakete wie der Green Deal (2019) zeichneten sich durch umfangreiche und ambitionierte Ziele aus. Mit einer Umgestaltung ganzer Wirtschaftssektoren sollte die EU bis 2050 klimaneutral werden. Nun, sechs Jahre später, sind wir diesem Ziel tatsächlich nähergekommen. Und trotzdem schwächelt die EU.
Dass sich in Europa etwas verändert hat, wurde im Vorfeld der COP in Brasilien deutlich: Eigentlich hätte die EU ihr gemeinsames Klimaziel bereits Monate vor der Konferenz in Belém einreichen müssen – dann schienen die Verhandlungen aber zäher denn je. Erst in letzter Minute gelang es den EU-Umweltministern, sich auf gemeinsame Klimaziele zu einigen. Und auch diese Ziele waren geprägt von Kompromissen – etwa, weil die die Treibhausgaseinsparungen der EU nun auch durch den Ankauf von Zertifikaten außerhalb Europas erreicht werden sollen. Experten befürchten, dass es so zu einer Aushöhlung der Klimaziele kommen kann.
"Die tatsächliche Emissionsvermeidung durch Emissionsgutschriften ist mit vielen Risiken und Unsicherheiten behaftet. Es ist sehr schwierig zu beurteilen, ob die Emissionen langfristig vermieden werden und vor allem, ob die Einsparung wirklich ‚zusätzlich‘ war", erklärt Johannes Emmerling vom European Institute on Economics and the Environment (EIEE) in Mailand.
Die EU verhandelt auf der COP traditionell gemeinsam
Für die COP30 in Belém war das nicht unbedingt ein gutes Vorzeichen. Immerhin hat die Europäische Union eine Art Schlüsselrolle auf der internationalen Klimakonferenz: Die 27 Mitgliedstaaten sprechen dort quasi "mit einer Stimme": Sie setzen sich gemeinsam für die gleichen Ziele ein – und bisher waren das stets ambitionierte Klimaschutzziele. Nun könne man beobachten, dass sich innerhalb der Europäischen Union Lager bilden, sagt Anna Holzscheiter, Inhaberin der Professur für Politikwissenschaft an der TU Dresden mit Schwerpunkt internationale Politik: "Staaten, in denen die Haushaltslage noch schlechter ist als in Deutschland, wie zum Beispiel Frankreich, schlagen sich nun auf die Seite derjenigen, die beim Klimaschutz zurückfahren wollen", findet Holzscheiter.
Dieses Muster ist in der Klimapolitik nicht neu: Viele Staaten setzen sich ambitionierte Klimaziele, weichen jedoch von ihnen ab, wenn sie befürchten, dass ihnen das wirtschaftlich schadet. Aktuell ist die wirtschaftliche Lage in vielen Ländern angespannt – der Effekt vervielfacht sich also, gerade auch innerhalb der EU.
Sündenbock Klimaschutz
Dass Europa in Klimafragen derzeit nicht mit einer Stimme spricht, liegt aber nicht allein an der wirtschaftlichen Lage. Häufig ist der Widerstand gegen Klimaschutz auch eine Frage der Ideologie. Seit dem Abkommen in Paris 2015 haben sich die politischen Konstellationen verändert. In diversen EU-Ländern sind mittlerweile rechts-konservative Regierungen im Amt. "Das Thema Klima eignet sich nun mal sehr gut für die Mobilisierung von rechts", sagt Anna Holzscheiter von der TU Dresden. Aus ihrer Sicht sei die Klimapolitik in diesen Ländern eine Art Sündenbock geworden. Für wirtschaftliche Misserfolge werden dann mitunter klimapolitische Maßnahmen verantwortlich gemacht – auch wenn es daran vielleicht nicht immer liegt. Grundsätzlich bestehe hier aber auch ein Zusammenhang mit einer generell gestiegenen EU-Feindlichkeit, wie sie etwa in Polen und einigen anderen osteuropäischen Ländern zu beobachten sei, findet die Politikwissenschaftlerin.
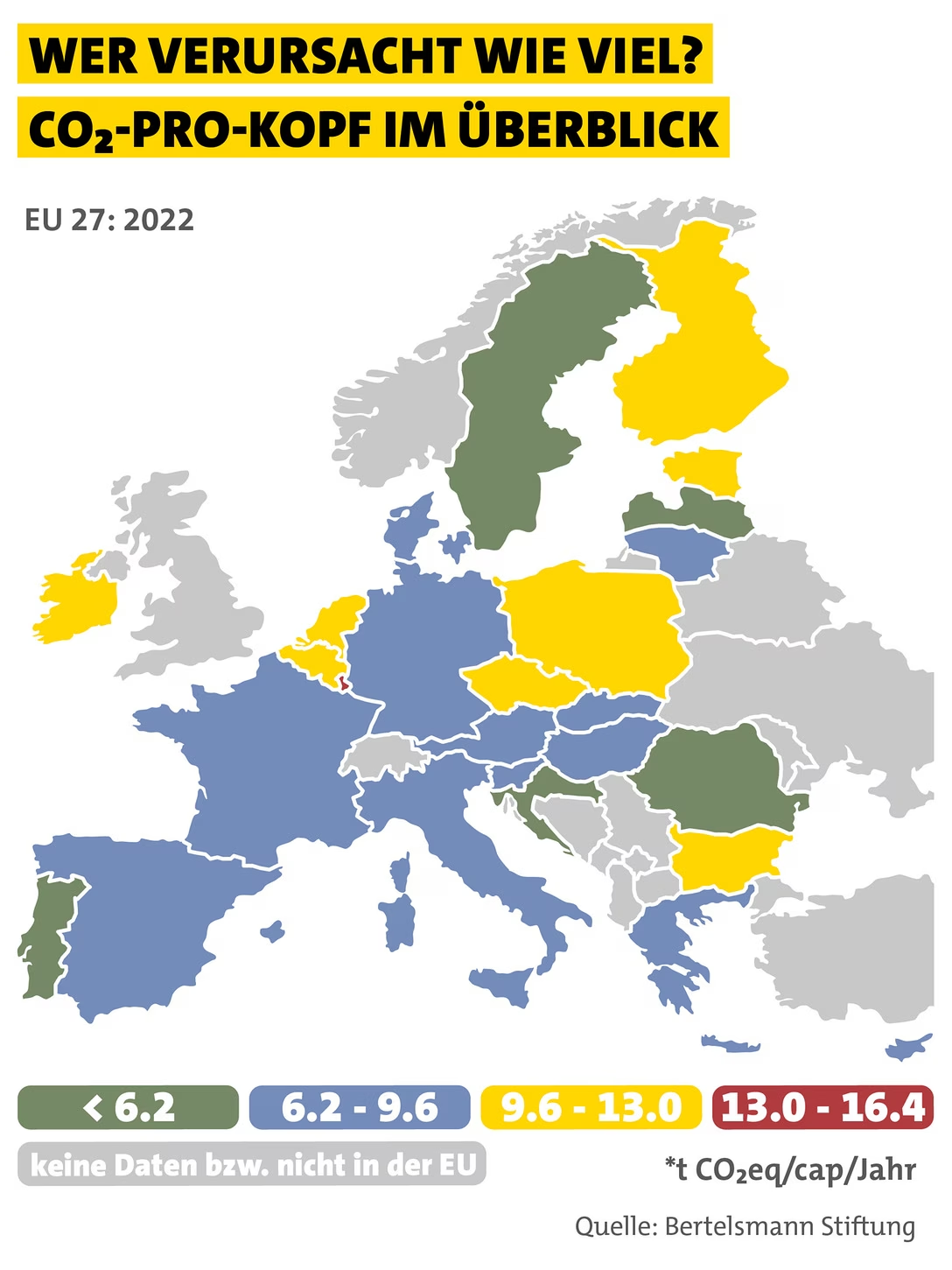 Bildrechte: MDR WISSEN
Bildrechte: MDR WISSENAuf der diesjährigen COP kann man noch einen dritten Widerstand gegen Klimapolitik ausmachen: Laut einer aktuellen Recherche der NGO Kick Big Polluters Out (KBPO) sind in Brasilien aktuell 1.600 Lobbyisten für fossile Brennstoffe vor Ort. Das sind so viele, wie noch bei keiner COP zuvor. Bei 40.000 Teilnehmer insgesamt bedeutet das: Jeder 25. Teilnehmer ist Teil einer Lobby, die sich für den Erhalt einer klimaschädlichen Industrie einsetzt. Und das, obwohl man die Teilnehmerzahl eigentlich reduzieren wollte. Dass die Lobbyisten derart zahlreich auf der Konferenz vertreten sind, dürfte im Wesentlichen damit zusammenhängen, dass die Unternehmen sich bedroht fühlen. Was wiederum dafür spricht, dass die Konferenz es doch schaffen kann, fossile Energien wesentlich zu beschränken.
Inhaltlicher Schwerpunkt: Der Regenwald-Fund
Denn: Sogar angesichts der ideologischen Abneigung einiger Staaten gegenüber dem Klimaschutz lassen sich auf der Sachebene möglicherweise Erfolge erzielen. "Das, was auf der COP verhandelt wird, ist dann am Ende auch sehr technisch", betont Anna Holzscheiter. Möglicherweise könne es für die Verhandlungen hilfreich sein, die Ideologie auf diese Weise rauszuhalten. Friedrich Bohn, Waldökologe am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig und auf der COP in Brasilien vor Ort, betont: "Nachdem die COP nun drei Jahre in autoritären Staaten stattgefunden hat, merkt man den Einfluss der Zivilgesellschaft wieder deutlicher." Ein inhaltlicher Schwerpunkt der Verhandlungen in diesem Jahr: Der Schutz des tropischen Regenwaldes mit einem eigens angelegten Fund (TFFF).
Nachdem die COP nun drei Jahre in autoritären Staaten stattgefunden hat, merkt man den Einfluss der Zivilgesellschaft wieder deutlicher.
Waldökologe Bohn betont, der Fund sei wichtig, weil er den Wäldern in den Tropen einen "monetären Wert gibt". Somit werde es wirtschaftlich weniger attraktiv, den Wald zugunsten von Landwirtschaft und Bergbau abzuholzen. "Der Fund soll langfristig ein Volumen von 125 Milliarden Dollar haben und wäre dadurch einer der größten der Welt", erklärt der Forscher. Das Geld soll von Staaten und Akteuren aus der Privatwirtschaft in den Fund eingezahlt werden – bestenfalls schon während der COP. Deutschland verkündete bereits, eine Milliarde beisteuern zu wollen.
Die konkreten Pläne sind nach wie vor unzureichend
Außerdem sieht das Pariser Klimaabkommen vor, dass alle Länder alle fünf Jahre konkrete Pläne zum Erreichen des 1,5 Grad-Zieles vorlegen müssen. Denn, während das Ergebnispapier am Ende der COP eine Absichtserklärung ist, muss danach mit den sogenannten "Nationally Determinded Contributions", kurz NDCs dargelegt werden, wie man diese Absicht erreichen will. In diesem Punkt besteht schon länger eine Umsetzunglücke. Auch die aktuell auf der COP verhandelten Anstrengungen der Länder seien unzureichend, betont Friedrich Bohn. Nun verhandle man deshalb bereits darüber, was passieren muss, damit die Länder beim nächsten Zielabgleich in fünf Jahren ambitioniertere Pläne vorlegen.
Das zeigt bereits: Nicht allein das Ergebnispapier einer COP entscheidet über Erfolg oder Misserfolg. Häufig sind die Prozesse langfristiger. Bei der Veröffentlichung unseres Klima-Updates sind die Ergebnisse der COP30 noch unklar. Auch, wie das Auseinanderstreben der EU die Ergebnisse beeinflusst haben könnte, ist schwer zu sagen, weil die Verhandlungen nicht öffentlich sind.
Wie die COP in Brasilien ausgeht, erfahren Sie im Podcast ARD Klima Update in einer Sonderfolge, die voraussichtlich am Sonntagvormittag veröffentlicht und hier abgerufen werden kann. Den wöchentlichen Newsletter ARD Klima-Update können Sie kostenlos hier abonnieren:
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke


