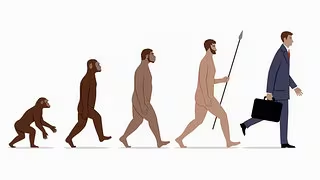Bis vor wenigen Jahren sah es so aus, als ob die somalische Regierung den Bürgerkrieg im Land beenden könnte. Doch mittlerweile haben die Islamisten wieder die Oberhand und stehen vor der Hauptstadt. Wie ist es dazu gekommen?
Der somalische Präsident Hassan Sheikh Mohamud gab sich bei einer Konferenz in diesem Frühjahr wieder einmal siegesgewiss. "Terroristen haben keinen Platz in Somalia", erklärte der 69-jährige Staatschef. Tatsächlich aber ist die islamistische Al-Shabaab-Miliz in dem ostafrikanischen Land auf dem Vormarsch und nahe an die Hauptstadt Mogadischu herangerückt.
Es ist ein herber Rückschlag für das Land am Horn von Afrika, das seit rund 20 Jahren gegen die Al-Kaida-nahe Miliz kämpft. Dabei schien es 2022 noch so, als könnte die somalische Regierung die Kontrolle über das Staatsgebiet zurückerobern.

Mangelnde Kapazitäten und Prioritäten
Doch das militärische Blatt hat sich wieder zu Gunsten der Al-Shabaab-Miliz gewendet. Regierung und Armee ist es nicht gelungen, die eroberten Gebiete zu sichern. Dazu fehlten ihr oft die Kapazitäten, meint Ulf Terlinden, Leiter des Horn-von-Afrika-Büros der Heinrich-Böll-Stiftung mit Sitz in Nairobi. "Denn am Ende sind es ja nicht die Kampfverbände, mit denen man das Gelände eingenommen hatte, die dann nach der Vertreibung von Al-Shabaab eine zivile Ordnung absichern könnten."
Zugleich scheine die Regierung den Aufbau lokaler Verwaltungsstrukturen in den zurückeroberten Gebieten vielerorts nicht als Priorität zu sehen. Dabei müsste sie eigentlich dafür sorgen, dass der Staat für die Bevölkerung so schnell wie möglich sichtbar wird: durch Sicherheit, Schulen, Krankenhäuser, eine funktionierende Justiz.
Nur dadurch könnte sich der Staat längerfristig Relevanz und Legitimität erarbeiten, meint Terlinden. Das passiere jedoch in der Regel nicht. Durch dieses Versagen verliert der Staat die Loyalität der Bevölkerung, was der Al-Shabaab-Miliz in die Hände spielt.
Miliz lockt mit viel Geld
Die Miliz ist auch wegen der weit verbreiteten Armut für viele Menschen attraktiv. Der Weltbank zufolge lebt mehr als die Hälfte der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze. Der Kampf um das wirtschaftliche Überleben treibt vor allem junge Menschen dazu, bei der Miliz anzuheuern.
Denn die zahlt schon einfachen Kämpfern einen Sold von bis zu 300 US-Dollar, was ungefähr dem Gehalt eines somalischen Polizisten entspricht. Nach Schätzungen der Europäischen Union hat Al-Shabaab bis zu 12.000 Kämpfer, "die genaue Zahl ist nicht bekannt", heißt es in einem EU-Bericht.
Geld hat die Terrorgruppe jedenfalls genug. Laut Somalia-Experten der Vereinten Nationen treibt sie jedes Jahr um die 150 Millionen US-Dollar ein, zuletzt sogar 200 Millionen. Und das nicht nur in den Gebieten, die sie militärisch kontrolliert, sondern auch in Mogadischu.
Das bestätigte ein ehemaliger Sicherheitsberater des somalischen Präsidenten, Hussein Sheikh Ali, schon 2020. "Sie besteuern alle Waren, die importiert und exportiert werden - genauso, wie die Regierung", erklärte Hussein Sheikh. "Die Miliz hat viele staatliche Institutionen infiltriert." Die Bevölkerung habe gar keine andere Chance, als mit Al-Shabaab zu kooperieren. "Andernfalls würde sie die Konsequenzen zu spüren bekommen."
Verliert Somalia die Mission der Afrikanischen Union?
Ein weiteres Problem: Trotz der jüngsten, massiven Rückschläge soll die somalische Armee bis 2029 ihren wichtigsten internationalen Partner verlieren, die Eingreiftruppe der Afrikanischen Union (AU). Diese kämpft seit 2007 mit wechselnden Mandaten und Namen an der Seite der somalischen Armee.
Denn mit dem Zusammenbruch des somalischen Staates nach dem Sturz des letzten Diktators Siad Barre 1991 war auch die nationale Armee zerfallen. Die Eingreiftruppe der Afrikanischen Union soll die somalische Armee unterstützen, bis diese das Staatsgebiet, die Regierung und die Bevölkerung wieder selbst sichern kann. Bislang ist das nicht gelungen.
Trotzdem wird die AU-Mission seit einigen Jahren entsprechend der ursprünglichen Idee beständig verkleinert. In spätestens vier Jahren soll sie überflüssig sein. Doch ob sie überhaupt so lange durchhält, ist derzeit offen, warnt Omar Mahmood, Ostafrika-Experte der Denkfabrik International Crisis Group.
Denn derzeit sei die Finanzierung der Mission nicht gesichert. Die Europäische Union war seit 2007 der größte Geldgeber der AU-Mission, will aber nicht mehr fast alleine für deren Finanzierung aufkommen. Neue Geldgeber sind noch nicht gefunden.
EU will Stabilität im Land
Da die EU großes Interesse an einem halbwegs stabilen Somalia hat, hat sie seit 2007 rund 4,3 Milliarden Euro in die Sicherheit des Landes investiert. Erstens sind internationale Terrorgruppen, die dort ungestört operieren und Geld sammeln können, auch für Europa eine Bedrohung.
Zudem fördern Armut, der Mangel an Perspektiven und Rechtlosigkeit auch die Kriminalität auf See. Das wurde zwischen 2007 und 2012 schmerzhaft deutlich, dem Höhepunkt der Piraterie vor Somalias Küste. In der Hochphase wurden rund 180 Frachter und Handelsschiffe gekapert, etwa 860 angegriffen - ein harter Schlag für den internationalen Seehandel. Denn Somalia liegt am Golf von Aden und damit an einer der wichtigsten Schifffahrtsrouten der Welt.
Mehrere internationale Marinemissionen, darunter die EU-Mission Atalanta, halfen deshalb dabei, dass die Piraterie vor gut zehn Jahren zum Erliegen kann. Doch seit 2023 nimmt die Zahl der Angriffe wieder zu. "Wenn niemand zusätzliches Geld gibt, wird die AU-Mission vermutlich nicht sofort ihre Zelte abbrechen und sofort abreisen", meint Mahmood. "Aber sicher würden die Kapazitäten und Fähigkeiten der Truppe leiden, und natürlich deren Moral."
Mit der Zeit würde die Fähigkeit Somalias, sich zu verteidigen, weiter geschwächt, meint Mahmood. "Und das könnte Al-Shabaab auf jeden Fall ausnutzen."
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke