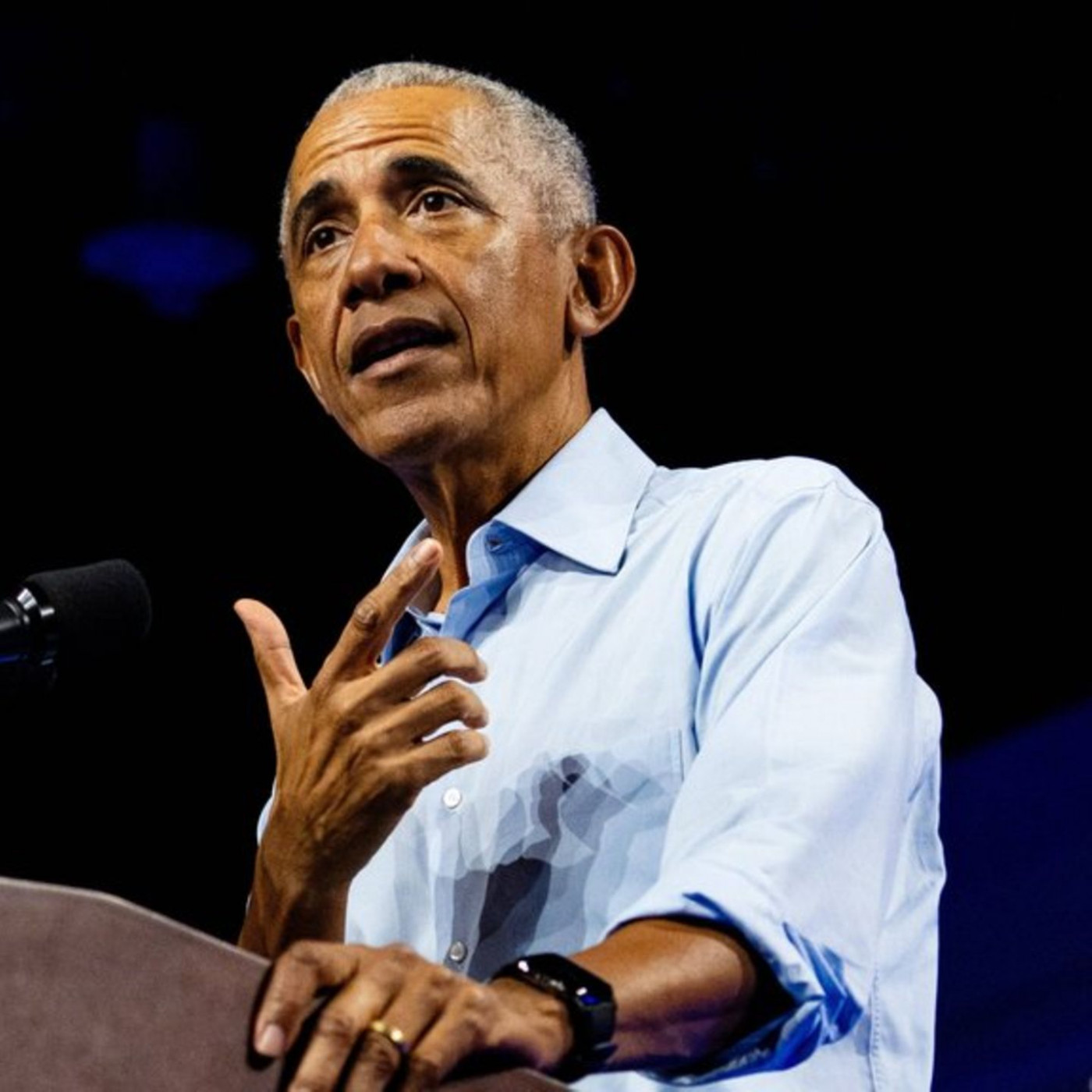Am Anfang ist das Wort, und das Wort ist die Stimme von Jens Harzer, die durch den dunklen Saal der Berliner Ensembles schwingt. Kurz darauf tritt der Schauspielstar auf seiner Kanzel ins Licht: eine Lichtgestalt. Das Wort hat nun auch einen Körper, der von der Sprache durch so unterschiedliche Gefühlszustände getrieben wird, dass es einem beim Zuschauen schwindelig werden kann. Mit „De Profundis“, einem Brief von Oscar Wilde aus dem Gefängnis, stellt sich der aus Hamburg gekommene Träger des Iffland-Rings dem Berliner Publikum vor. Ein sensationeller, unvergesslicher Solo-Abend.
Die Zerrissenen, die transzendental Haltlosen und metaphysisch Taumelnden, das sind die Figuren für Harzer. Vor wenigen Wochen hat er noch „Iwanow“ am Schauspielhaus Bochum abgespielt, eine seiner größten Rollen der vergangenen Jahre. Ein Mensch, in dessen Melancholie sich der reißende Fluss alles Vergehenden spiegelt, der sich ins Nichts vortastet. Und am Thalia-Theater Hamburg stand Harzer ein letztes Mal in Dimiter Gotscheffs Inszenierung von Peter Handkes „Immer noch Sturm“ auf der Bühne, als Erzähler inmitten des unaufhörlich herabrieselnden Kontinuums der Geschichte, der einen Sinn festzuhalten sucht.
Nun hat es Harzer nach Berlin gezogen. Lange am Thalia unter Vertrag, stand mit dem Ende der Intendanz von Joachim Lux eine Veränderung an, zudem in Bochum sein vertrauter Regisseur Johan Simons ins vorletzte Jahr als Leiter des Schauspielhauses geht (und diese Spielzeit erstmals am Berliner Ensemble inszenieren wird, was wohl auch Harzer zu verdanken ist). Am Wiener Burgtheater sollte Harzer vergangenes Jahr in „Hamlet“ spielen, doch das zerschlug sich. So konnte Oliver Reese Harzer fürs Ensemble am Schiffbauerdamm verpflichten und den ersten Auftritt seines neuen Stars inszeniert der Intendant gleich selbst.
„De Produndis“ ist ein Brief, den Oscar Wilde aus dem Zuchthaus an seinen Geliebten Alfred Douglas geschrieben hat, das Dokument einer gequälten Seele, die schonungslos sich selbst und sein Gegenüber erkundet. Was Hansjörg Hartung auf die Vorderbühne gestellt hat, erweist sich mehr als Käfig denn als Kanzel. Die Enge des Raums lässt das von Wilde zutiefst verhasste und verachtete Gefängnis, in das er nach einem Prozess wegen schwuler „Unzucht“ eingesperrt wurde, nachempfinden. Dass dieses einschnürende Bühnenbild auch auf die Dauer von fast zwei Stunden nicht langweilig wird, ist nicht zuletzt der spektakulären Lichtregie von Steffen Heinke zu verdanken.
Harzer, am Anfang noch aufrecht im über dem Anzug hochgeschlossenen Mantel stehend (Kostüm von Elina Schnizler), wühlt sich über den Abend immer mehr aus seiner Garderobe und somit aus den Konventionen seiner Zeit heraus, reißt sich das letzte Hemd vom Leibe. Er wolle sich seiner Strafe nicht schämen und in die völlige Demut eintreten, so schreibt es der Autor von „Das Bildnis des Dorian Gray“. Und wie in der berühmten Geschichte des Mannes, der ewig jung und schön bleiben will, während sein Porträt mit seinen Sünden für ihn altert, so geht es auch in „De Profundis“ um das Verhältnis von Selbst, Welt und Kunst, und letztlich gar um Gnade und Vergebung.
Es ist ein Ringen, das Harzer bis zur Erschöpfung zeigt, ein Ringen darum, wie noch die bittersten Erfahrungen in das Kunststreben eingehen können, auch das Schlechte und das Böse. Jedes Erleben wird verdoppelt, in einen Wirklichkeit- und einen Kunstwert und dazwischen agiert der Künstler mit seinem endlichen Leben und Lieben als unermüdlicher Umwerter aller Werte. Nichts verschweigen! Auch mit den Abgründen und den Gewalten leben, auch die Sünde soll heilig nennen! Das Dasein in jedem Moment voll akzeptieren. In den Worten Wildes hallen die seines Zeitgenossen Friedrich Nietzsche wider, ein Bruder des Ästhetizismus im Geiste, ebenfalls 1900 verstorben.
Doch so schön die Kunst auch ist, sie braucht das Leben, das es meist weniger ist. „Es war viel zu oft zu wenig schön mit dir“, schreibt Wilde an seinen Geliebten. Eine halbe Stunde Kunst sei ihm lieber als ein ganzer Tag mit ihm – und kommt doch nicht los von ihm. Wartet auf den Brief ins Gefängnis, der nie kommt, und will sich doch nicht in Gram versenken, sondern immer wieder die Liebe, die Fantasie und die Vorstellungskraft beschwören. Harzer schafft es, diese Sehnsucht zu zeigen, das Hoffen auf die Liebe und die Kunst als den Geheimagenten des Möglichkeitssinns. Das ist nicht nur l’art pour l’art, wie Wilde in seinem genialen Essay „Die Seele des Menschen im Sozialismus“ schreibt.
Die Natur ist gnädiger als die Gesellschaft
Harzer zeigt Wilde als Kunstgläubigen – durch die Orgelklänge von Jörg Gollasch noch verstärkt – im Moment seines tiefsten Falls, der sich die Pulsadern durchzubeißen versucht und nicht aufhören kann, auf ein anderes Ende zu hoffen. Ein Verstoßener, dem bewusst geworden ist, wie klein der Schritt vom Ruhm zur Schande ist. Der erfahren muss, dass die willenlose Natur gnädiger ist als die urteilende Gesellschaft. „Man muss alles aufgeben“, heißt es gegen Ende. Um doch noch alles zu gewinnen?
Das zutiefst Faszinierende an diesem Abend ist, wie Harzer aus Wildes Brief ein psychologisch-philosophisches Schauspiel zaubert, das Kunst und Liebe als die unerlässlichsten Pathologien des Lebens feiert. Es gab in den vergangenen Jahren viele beeindruckende Solo-Abende am Berliner Ensemble, doch dieser übertrifft alle. Lange war am Schiffbauerdamm am Ende einer Vorstellung nicht mehr so ein Jubel zu vernehmen.
„De Profundis“ mit Jens Harzer läuft am Berliner Ensemble.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke