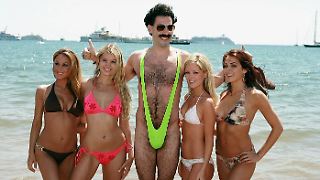Er war der Begründer der modernen Logik und ein Wegbereiter der analytischen Philosophie, die die Zusammenhänge zwischen Sprache, Mathematik und logischem Denken durchleuchtet. Zugleich hat sein Werk, obwohl einem rein philosophischen Erkenntnisstreben entsprungen, eine immense praktische Bedeutung. Es bildet – neben den Arbeiten des englischen Mathematikers George Boole – das Fundament der theoretischen Informatik und hat die Konstruktion heutiger Programmiersprachen erst möglich gemacht. Die Rede ist von Gottlob Frege, der vor hundert Jahren in Bad Kleinen bei Wismar starb, „einer der bedeutendsten Logiker aller Zeiten“, wie der Erkenntnistheoretiker Wolfgang Stegmüller Jahrzehnte später schrieb.
Freges Werk entfaltete seine enorme wissenschaftliche Wirkung erst lange nach dem Tod seines Autors. Zwar gehörten zu den wenigen Kollegen, mit denen Frege sich intensiv austauschte, namhafte Philosophen wie Bertrand Russell und Ludwig Wittgenstein, zwar wurden einige seiner Studenten internationale Koryphäen wie Gershom Scholem, der Erforscher der jüdischen Mystik, und Rudolf Carnap, der den „Wiener Kreis“ und sein Programm einer logisch fundierten „Einheitswissenschaft“ mitbegründete. Frege selbst jedoch blieb bis in die 70er-Jahre hinein auch in Fachkreisen ein Geheimtipp.
In seiner Heimatstadt Wismar begann man sich erst in den 80er-Jahren wieder an ihn zu erinnern. Noch zu DDR-Zeiten wurde der Wismarer „Turnplatz“ zum „Gottlob-Frege-Platz“; er bekam allerdings 1989 seinen alten Namen wieder. Dafür gibt es seitdem die „Prof.-Frege-Straße“, die davor „Leningrader Straße“ hieß. Seit 2000 pflegt an der Hochschule Wismar das Gottlob-Frege-Zentrum das wissenschaftliche Vermächtnis mit Publikationen und Tagungen. Trotzdem – einer breiteren Öffentlichkeit ist Frege bis heute unbekannt.
An der Universität Jena, wo er als Mathematikdozent fast vierzig Jahre lang bis zu seiner Emeritierung 1917 lehrte, galt der kleine, unscheinbare Mann „als ein scharfsinniger, aber weder als Mathematiker noch als Philosoph fruchtbringender Sonderling.“ So erinnerte sich der Philosoph Edmund Husserl nach Freges Tod. Frege war introvertiert und galt als schwierig, über Netzwerke verfügte er nicht, seine wissenschaftlichen Publikationen wirkten auch auf Fachkollegen hermetisch.
Seine mathematischen Pflichtvorlesungen zur Mechanik waren immerhin mäßig besucht. Aber in seine Lehrveranstaltungen zur Sprachphilosophie und Logik, denen seine Leidenschaft galt, verirrten sich nur wenige Studenten, oft kam die geforderte Mindestzahl von drei Teilnehmern nur mit Mühe zustande.
„Er schaute seine Zuhörer kaum an. Gewöhnlich sahen wir nur seinen Rücken, wenn er die seltsamen Diagramme seines Symbolismus an die Tafel schrieb und erklärte. Niemals, weder während der Übung noch nachher, stellte ein Student eine Frage oder machte eine Bemerkung. Die Möglichkeit einer Diskussion schien ganz undenkbar“, beschrieb Rudolf Carnap Freges sperrigen Vorlesungsstil, von dem er sich jedoch nicht abschrecken ließ. Er gehörte zu den wenigen, die sich von Frege begeistern ließen und ihm in die dünne Luft der Abstraktionen und des reinen Denkens folgten.
Im modularisierten Hochschulbetrieb unserer Tage, wo alerte Selbstvermarktung, didaktische Lehrstoffverpackung, erfolgreiche Drittmittelaquise und ein großer Publikationsausstoß wesentliche Voraussetzungen für eine Akademikerkarriere bilden, wäre Frege über den Status einer wissenschaftlichen Hilfskraft wohl kaum hinausgekommen. Auch an der kaiserzeitlichen Universität Jena war seine Laufbahn bescheiden. Immerhin wurde er 1896 endlich zum „ordentlichen Honorarprofessor“ ernannt. Das brachte ihm eine Festanstellung, wenn auch keinen Sitz in der Fakultät. Zuvor war er als „außerordentlicher Professor“ auf die Hörergelder seiner Studenten angewiesen gewesen.
Die Logik bestand für Frege aus den ewig gültigen Regeln des richtigen Denkens und Schließens. Logische Wahrheiten existierten für ihn in einem eigenen rationalistischen „Reich“, angesiedelt zwischen bloß subjektiven Vorstellungen einerseits und der physischen Welt andererseits. Freges Ziel war die Entwicklung einer streng logisch aufgebauten Symbolsprache nach dem Vorbild der Algebra. Sie sollte das „reine Denken“ eins zu eins wiedergeben, ohne die Vagheiten und Täuschungen der „Wortsprachen“. So nannte Frege die natürlichen Sprachen wie Deutsch, Französisch oder Latein.
Für dieses Projekt, dem sich schon Leibniz gewidmet hatte, taugte die traditionelle Logik nicht, die seit Aristoteles weitgehend unverändert geblieben war. Mit ihrer Unterscheidung von Subjekt und Prädikat war sie nach Freges Geschmack viel zu sehr den irreführenden Strukturen der natürlichsprachlichen Grammatik verhaftet.
Wo das Prädikat ins Leere ragt
So haben beispielsweise die Sätze „Der Astronaut betrat den Mond“ und „Niemand betrat den Mond“ die gleiche grammatische Oberflächenstruktur. Ihre logische Tiefenstruktur aber unterscheidet sich komplett. Das Subjekt des zweiten Satzes (Niemand) steht im Gegensatz zu dem des ersten weder für ein Lebewesen noch für einen Gegenstand. Es steht für gar nichts. Das Prädikat „betrat den Mond“, das im ersten Satz die Handlung einer Person beschreibt, ragt hier ins Leere.
Andererseits kann sich unter unterschiedlichen grammatischen Strukturen dieselbe logische Aussage verbergen: Der Passivsatz „Der Mond wurde vom Astronauten betreten“ bezeichnet denselben Sachverhalt wie sein aktives Gegenstück, obwohl jetzt der Mond das Subjekt ist.
Frege wollte solche grammatischen Vexierbilder verbannen, indem er ein streng definiertes Notationssystem entwickelte, das wie ein Röntgenbild das logische Gerüst der Sprache freilegt. In abgewandelter Form finden sich diese Formalismen in den Strukturen heutiger Programmiersprachen wieder.
Dabei erkannte Frege durchaus an, dass die normale Sprache gerade wegen ihrer Unschärfen und kontextabhängigen Mehrdeutigkeiten für die Bedürfnisse der Alltagskommunikation gut geeignet ist. Er verglich sie mit der Flexibilität des menschlichen Auges, seine logische Kunstsprache hingegen mit dem eng begrenzten, aber tiefgehenden Blick durch das Mikroskop.
Freges zweites großes Vorhaben war die Grundlegung der Arithmetik durch die Logik. So wollte er das Wesen der Zahlen bestimmen und nachweisen, worauf die Wahrheit von Gleichungen wie 2 x 2 = 4 eigentlich beruht. Frege fasste Zahlen als eigene logische Gegenstände auf, die er mithilfe des Mengenbegriffs definierte: So ist „3“ die Menge aller Mengen, die drei Elemente umfassen und damit „Dreiheit“ als Eigenschaft aufweisen – eine scheinbar umständliche, aber dafür logisch strikte Definition eines alltäglichen Begriffs.
Doch 1902 erlitt Frege einen schweren Rückschlag, als ein Brief aus Cambridge eintraf: Bertrand Russell wies Frege darauf hin, dass dieser mit dem Mengenbegriff in sein scheinbar widerspruchsfreies System den Sprengsatz der Paradoxie platziert hatte. Was gemeint ist, illustriert die Geschichte vom Hauptmann, der dem Friseur seiner Kompanie den Befehl erteilt, die Soldaten zu rasieren – aber nur die, die sich nicht selbst rasieren. Den armen Barbier stürzt das Kommando in eine Endlosschleife des Selbstwiderspruchs: Rasiert er sich, verstößt er gegen den Befehl ebenso, wie wenn er sich nicht rasiert.
Wesentliche Leistungen Freges blieben durch diese Paradoxien zwar unberührt und zudem fanden Russell und andere Logiker formale Auswege aus den Fallen der Selbstbezüglichkeit. Trotzdem betrachtete Frege sein eigentliches philosophisches Vorhaben, die Arithmetik als ein Gebilde nachzuweisen, dessen Sätze nicht nur gelten, sondern sich auch rein logisch nachweisen lassen, als gescheitert.
Als Freges Frau Margarete 1904 nach langer Krankheit starb, geriet er in eine Lebens- und Schaffenskrise, die er erst nach Jahren überwand. Nicht nur privat, auch als Wissenschaftler blieb Frege weitgehend isoliert. Selbst mit seinem Bewunderer Ludwig Wittgenstein, der Frege ein paar Mal besuchte und mit ihm viele Jahre lang korrespondierte, fand er keine gemeinsame philosophische Basis. Als Wittgenstein ihm sein Hauptwerk, den „Tractatus logico-philosophicus“ schickte, blieb Frege schon in den ersten Absätzen an den logischen „Unklarheiten“ vieler Wörter und Formulierungen hängen. Wittgenstein wiederum war tief enttäuscht und schließlich erschöpft, weil es ihm trotz aller Anstrengung nicht gelang, Frege den „Tractatus“ nahezubringen.
Vor Hitler schützte ihn Logik nicht
Ein politisch trübes Licht fiel auf Frege, als 1994 Tagebuchaufzeichnungen publiziert wurden, die er im Jahr vor seinem Tod gemacht hatte. Frege war die längste Zeit seines Lebens ein nationalliberaler Patriot und Bismarck-Verehrer gewesen. Die Erfahrung wirtschaftlicher Not durch die Hyperinflation und die empfundene Demütigung durch den Versailler Vertrag, der Deutschland und seinen Verbündeten die alleinige Kriegsschuld zuschob, hatten diese Einstellung in bittere völkisch-nationalistische, antisemitische und antidemokratische Ressentiments kippen lassen. Neben Ludendorff erschien Frege auch Hitler, dessen Menschheitsverbrechen er freilich nicht voraussehen konnte, als Hoffnungsträger.
Dass die ihm verhassten Sozialdemokraten die Regierung der Weimarer Republik aus staatspolitischem Verantwortungsbewusstsein übernommen hatten, dass nicht sie, sondern die militärisch-politische Elite der untergegangenen Monarchie die Nation in die verzweifelte Lage manövriert hatten – all das konnte oder wollte der sonst so scharfsinnig urteilende Frege nicht sehen.
Politisch zeigte er sich am Ende seines Lebens als ein gefährlich schlichtes Gemüt. An der Brillanz des Wissenschaftlers und der bleibenden Bedeutung seines Werkes ändert das nichts.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke