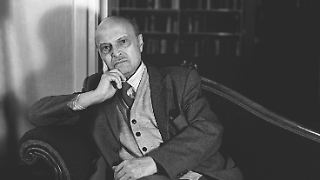Am Darmstädter Staatstheater steht in roten Lettern „Ist das echt?“. Werbung für die aktuelle Spielzeit. Das „Geständnis“, das Ursula Krechel hier in ihrer Dankesrede zum Georg-Büchner-Preis 2025 ablegte, passte schon deshalb zum Ort der Veranstaltung, bei der traditionell auch der Johann-Heinrich-Merck-Preis für literarische Kritik und der Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa verliehen wurden. Ersterer ging an die Schweizer Kritikerin Ilma Rakusa, letzterer an den israelisch-deutschen Historiker Dan Diner.
„Einmal, oder war es zweimal oder mehrmals, oder hab ich es verdrängt“, überlegte die 1947 in Trier geborene Schriftstellerin, sei sie mit dem Gesetz in Konflikt geraten – vor genau 50 Jahren. Es sei um ein Flugblatt zu Schwangerschaftsabbrüchen gegangen, „vielleicht eine Landbotin“. Jemand habe „verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes“ sein müssen. Krechel habe dann mit „Luise Büchner“ gezeichnet. Ein Name lasse sich leicht fingieren, sagte sie jetzt.
Luise Büchner, der acht Jahre jüngeren Schwester des Namenspatrons des Preises, der ihr soeben vom Akademiepräsidenten Ingo Schulze überreicht worden war, hatte Krechel weite Teile ihrer Rede an diesem 1. November gewidmet. 1821 in Darmstadt geboren und dort auch 1877 gestorben, kämpfte Büchner für die Mädchenbildung. Großherzogin Alice wurde ihre Förderin, Büchner Gesicht der „Alice-Frauenvereine“. Sie schrieb auch Lyrik und Prosa, gab mit ihrem Bruder Alexander eine Gedichtsammlung heraus.
Krechels Geständnis und das Bekenntnis, „verantwortlich mit allen Sinnen“ zu sein, war ein Kommentar auch zum Thema der Herbsttagung der Akademie: „Linguistik der Lüge“. Der gleichnamige Essay war die Gewinner-Antwort des Sprachwissenschaftlers Harald Weinrich (1927-2022) auf eine 1964 gestellte Akademie-Preisfrage.
Hat Merz gelogen?
Der Linguist Wolfgang Klein hielt den Eröffnungsvortrag am Donnerstag. Dass wir alle lügen, Lügen aber als schlecht gelten, war sein Ausgangspunkt. Das eine sei eine empirische Aussage, die Verwerflichkeit der Lüge Meinungssache. Und so hatten Kleins launische Ausführungen zwei Teile. Wenn man jemanden einer Lüge zeihen wolle, müsse man erstens wissen, was er wirklich meine, zweitens, was er wirklich glaube und drittens, wie es wirklich sei, so der Linguist vielleicht etwas kompliziert zum ersten Teil.
Um die ethische Frage zu beantworten, zog Klein unter anderem Kant heran. Der sah im Lügen eine Verletzung des kategorischen Imperativs. Hätte ein Mörder, der es auf den Philosophen abgesehen hätte, diesen gefragt, ob es sich bei ihm um sein prospektives Opfer handele, hätte Kant sicher bejaht, schmunzelte der Sprachwissenschaftler. Kant aber blieb sein Ausgangspunkt, als er ausführte, in puncto Lügen gäbe es widerstreitende Maximen: Etwa die des „Pursuit of Happiness“. Oder: anderen Menschen kein Leid zuzufügen. Man brauche in einem gegebenen Fall höchstens so viel Lüge, wie erforderlich sei, um nach den anderen beiden Prinzipien zu handeln.
Ob Friedrich Merz der Lüge zu zeihen ist, weil er seine „Stadtbild“-Äußerung damit erklärte, er habe nicht Ausländer an sich gemeint, sondern Arbeitslose ohne gültigen Aufenthaltstitel? So wollte es der Germanist und ehemalige Akademie-Präsident Heinrich Detering in der Diskussion zwischen Klein, dessen Kollegen Andreas Gardt und der „Spiegel“-Journalistin Ann-Katrin Müller. Die Metapher ziele aufs Visuelle. Aufenthaltsstatus und Anstellungsverhältnis seien aber kaum sichtbar. Klein winkte ab, man müsse wissen, was der Kanzler je wirklich gemeint habe. Detering gab dem Linguisten recht, man könne in niemandes Kopf gucken, aber es gebe Kohärenzkriterien, nach denen verschiedene Aussagen derselben Person bewertet werden können.
Später bekannte Klein, kaum noch Zeitungen zu lesen, denn Belege für das Berichtete, wie sie in der Wissenschaft notwendig seien, fehlten dort. Das mache es ihm unmöglich, eine Überprüfung vorzunehmen. Ann-Katrin Müllers Protest, auch der Journalismus belege, was er berichte, hinderten ihn nicht, bald den Klimawandel in den Blick zu nehmen: Der sei zwar nicht zu bestreiten, die Modellierungen aber so kompliziert und sich teils widersprechend, dass Prognosen äußerst fraglich seien. Klein sprach vom „Butterfly Effect“: Kleinste Ereignisse könnten enorme Folgen haben.
In der folgenden Runde mit Felicitas Hoppe, Uwe Timm und Judith Schalansky sah sich letztere genötigt, unter Applaus aus dem Saal zurückzuschießen: „Herr Klein meinte, die Modellierungen sind so schwer zu verstehen.“ Das stimme, „aber gleichzeitig wissen wir so wahnsinnig viel.“ Dass die Zukunft nach wie vor eine Frage des Orakels sei, solle nicht davor abschrecken, dass es Handlungsbedarf gebe. Das Argument, alles könne noch ganz anders kommen, „wenn der Schmetterling sich ein bisschen anders bewegt“, sei ein Beispiel von Wissenschaftsfeindlichkeit. Auch eine Spitze gegen Detering war zu vernehmen, als Hoppe fallen ließ, sie spreche jetzt „so moralisch wie Heinrich“.
Insgesamt zerfaserte auch diese zweite Runde, die sich um den Topos vom lügenden Dichter drehen sollte, spätestens, als Moderatorin Daniela Strigl ein Gespräch über den abwesenden Peter Handke anregte. Sie erinnerte daran, wie Akademie-Mitglied Saša Stanišić 2019 gegen den frisch gekürten Nobelpreisträger polemisiert hatte – Handke hatte in einem Buch von 1996 Kriegsverbrechen in Stanišićs Heimatstadt Višegrad auf eine für viele skandalöse Weise kommentiert. Der Vorwurf: Der Nobelpreisträger habe sich wirkliche Ereignisse „so zurechtlegt, dass dort nur Lüge besteht.“ Erfrischend, wenn auch nach der Diskussion um Merz etwas unterkomplex, Uwe Timms Antwort: Er würde „nicht das Böseste und Unangenehmste und Hinterhältigste“ unterstellen. „Irgendwas muss ja in seinem Kopf vorgegangen sein. Aber man müsste ihn fragen. Aber wir haben ihn hier nicht sitzen.“
Worte lügen nicht
Schulze hatte zu Beginn der Tagung die Namen verstorbener Akademie-Mitglieder verlesen: Peter von Matt, Albrecht Schöne, Alfred Brendel, Gertrud Leutenegger, Harald Hartung, Peter Eisenberg, Uwe Pörksen. Große Intellektuelle, die fehlen werden. Dass Schulze so begann, warf ein Licht auf den Doppelcharakter dieser drei Darmstädter Tage. Einerseits ein intimes Mitglieder-Treffen, will man andererseits nach außen wirken. Nicht zuletzt, weil die Finanzierung prekär ist, wie von Donnerstag bis Samstag oft betont wurde. Auf offene Ohren stieß man bei Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, der in seinem Grußwort zur Preisverleihung die Finanzierung der Herbsttagung 2026 zusicherte.
Die am Vorabend der Preisverleihung stattfindende Lesung der Büchnerpreisträgerin Ursula Krechel war der Höhepunkt dieses langen Akademie- Wochenendes. Nicht aus ihren Romanen wolle sie lesen, „die können Sie selber lesen“, sondern einen Gedichtzyklus und Kapitel aus ihrem Essay „Vom Herzasthma des Exils“ – der Titel ist von Thomas Mann geborgt. Das Kapitel über die Prager Journalistin Milena Jesenská, 1944 im KZ Ravensbrück gestorben und „gemeinhin bekannt als ‚Kafkas Milena‘“, die 1937 über Flüchtlinge aus Nazideutschland schrieb– „verordnete Nichtarbeit, systembedingte Arbeitslosigkeit, isoliert, deprimiert, diskriminiert“ – machte deutlich, was Laudatorin Sabine Küchler am Samstag über Krechels Schreiben sagte: Es ist der Versuch, „den vergessenen Menschen mit allen literarischen Mitteln ein Gesicht zu geben, einen Verstand und ein pochendes Herz.“
Dass Krechel mit ihrer Überzeugung, bestimmte Wörter nicht denen zu überlassen, die sie instrumentalisieren – hier das Wort „Remigration“ – vielleicht unbewusst an Weinrichs Preisschrift anknüpfte, war ein faszinierendes Detail. Weinrich nämlich wartet nicht zuletzt mit der Erkenntnis auf, mit einzelnen Wörtern lasse sich nicht lügen. Nur der Text, man könnte auch Kontext sagen, in dem ein Wort vorkommt, erlaubt es, über seine Lügenhaftigkeit zu entscheiden.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke