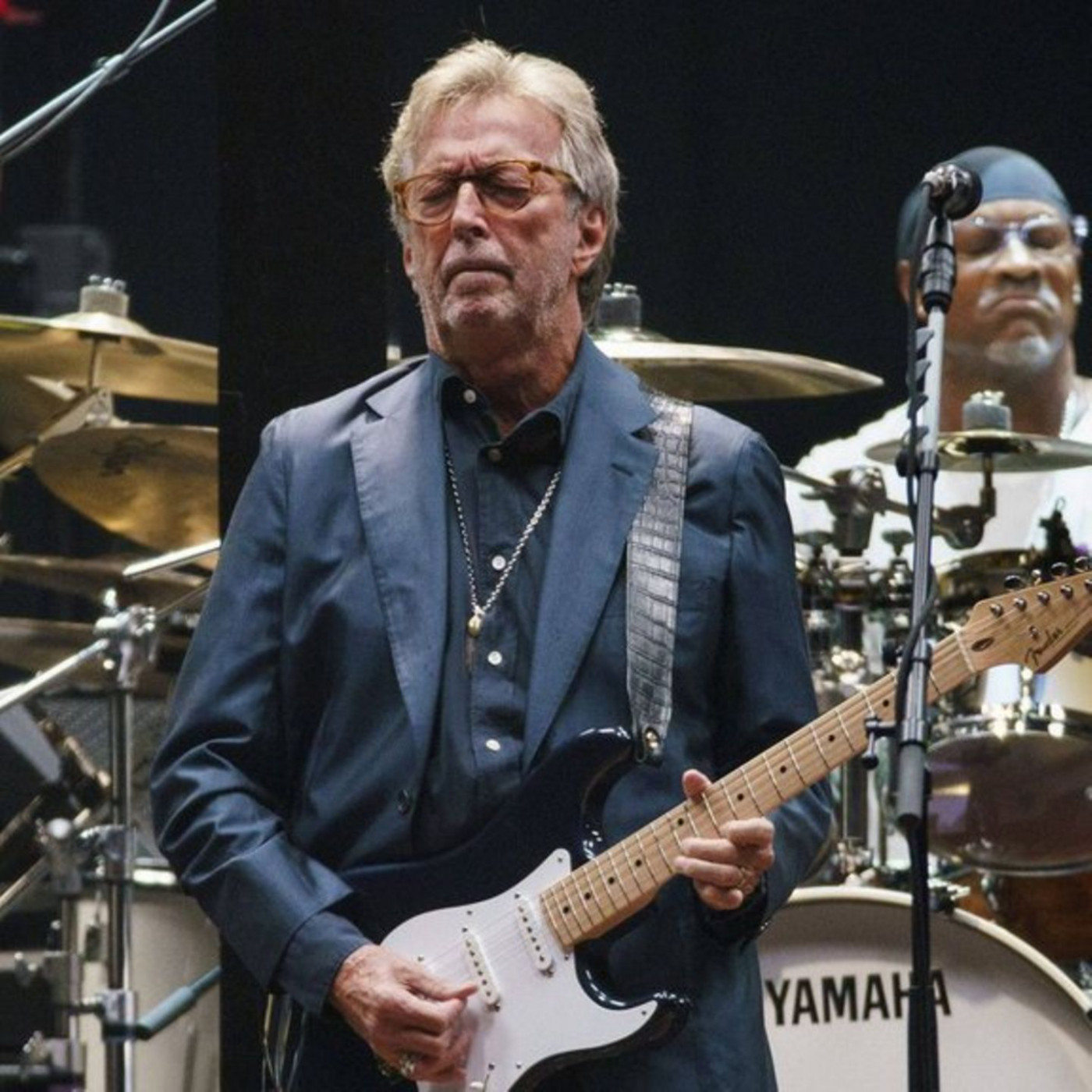Im April 1930 reiste Gottfried Benn nach Dänemark zur Konfirmation seiner Tochter und irritierte deren Pflegeverwandtschaft – aber ganz anders, als man es vielleicht erwartet hätte. Der zum Atheisten gewordene Pfarrerssohn, der Avantgarde-Dichter, der Poeme über Leichenschauhäuser und Krebsbaracken geschrieben hatte, der Frauenheld, der Bindungen fürchtete, wie die Pest – ausgerechnet er genoss es nun sichtbar, die Tochter feierlich an seinem Arm zur heiligen Handlung in der Kirche zu führen.
Aber wenn es um Nele ging, war eben immer schon alles anders. Als Benn um 1920 überlegte, die Berliner Familienwohnung und seine entfremdete Frau Edith ganz und gar zu verlassen, war die Beziehung zur Tochter erklärtermaßen das Einzige, was ihn zurückhielt.
Doch so weit, dass er die 1915 geborene Nele nach dem frühen Tod Ediths 1922 bei sich behalten hätte, ging die Liebe dann doch nicht. Er gab sie als Pflegekind zu seiner kinderlosen dänischen Geliebten, einer Opernsängerin, und ihrem Mann, einem Fabrikanten. Diese scheinbar herzlose Entscheidung traf bei allen auf erstaunliches Verständnis. Später auch bei der Tochter. Es konnte sich wirklich niemand vorstellen, dass der literarische Bürgerschreck mit dem unsteten Liebesleben und schlechtgehenden Arztpraxis für Haut- und Geschlechtskrankheiten allein um Nele kümmern würde.
Im Nachhinein erweist sich die Verpflanzung nach Dänemark als dreifacher Glücksfall – für die Tochter, für Benn selbst und für die literarische Nachwelt. Letztere verdankt der räumlichen Trennung einen 26-jährigen anrührenden Briefwechsel, der nun erstmals in Buchform vorliegt, 13 Jahre nach dem Tod Neles, die 2012 hochbetagt und viel gerühmt in Dänemark starb. Nele selbst ermöglichte die Verschickung durch den Vater ein Leben im Wohlstand außerhalb der Nazi-Diktatur und der Schrecken des Bombenkrieges und der Elendsjahre der Nachkriegszeit in Berlin.
Literarische Vater-Tochter-Beziehung
Als die Tochter in britischer Hauptmannsuniform in Berlin bei Benn klingelte, den sie Jahre nicht gesehen hatte, bot sich ein erschreckender Anblick: „Da stand er völlig verändert. Mein Vater war doch seit seinem dreißigsten Jahr immer vollschlank – dick wollen wir nicht sagen. An diesem Apriltag 1946 aber stand in der Tür ein ganz kleiner dünner Mann, der viel älter aussah, als seine bald sechzig Jahre. Seine Augen waren von schwarzen Rändern umgeben und lagen tief in den Höhlen. Ich musste weinen. Er sah unheimlich aus.“ Nicht zuletzt die Unterstützung durch Nele half ihm schließlich, seine körperliche und geistige Form wiederzufinden.
Er war aber auch sehr stolz und hätte noch stolzer sein können, wenn er länger als nur bis 1956 gelebt hätte, um die Karriere seiner Tochter zu verfolgen. Nele Poul Sørensen, geschiedene Topsøe, stieg auf zu einer der wichtigsten und geschäftlich erfolgreichsten Journalistinnen Dänemarks, die als konservative Feministin half, das Land zu modernisieren. Diese außergewöhnliche Frau übererfüllte alle Hoffnungen, die sowohl der geliebte Pflegevater (mit der Mutter verstand sie sich weniger) als auch der ferne biologische Vater in sie gesetzt hatten.
Letzterer schickte der kaum 15-Jährigen 1930 Bücher von sich selbst, Thomas und Heinrich Mann und dem dänischen Schriftsteller Jens Peter Jacobsen. Die Vater-Tochter-Beziehung war eben von Anfang an auch eine literarische: Den damals noch sehr ungewöhnlichen Rufnamen Nele wählte der 1915 in Brüssel als Militärarzt stationierte Vater nach einer Figur aus dem belgischen Nationalroman „Ulenspiegel“ von Charles de Coster.
Und kaum hat er sie nach 1946 wieder, schlachtet er eine Episode ums Familiensilber aus dem Besitz von Neles Mutter in der Erzählung „Der Ptolemäer“ poetisch aus. Nele, die sich dadurch in ein schlechtes Licht gestellt sieht, ist empört. Sie schreibt ihm: „Ich verbitte mir freundlichst je wieder ein Geschenk von dir oder Ilse (Benns neuer Frau).“ Der Vater muss einen diplomatischen Brief schreiben, in dem er alles zur Fiktion und die Ähnlichkeit für zufällig erklärt.
Das ist natürlich glatt gelogen, doch die Mühe, die er sich damit macht, zeugt einmal mehr davon, wie wichtig ihm Nele war. Die Briefe zeigen Benn, mehr noch als die Korrespondenzen mit diversen Geliebten und Freunden, von einer menschlich berührbaren Seite, die er in seiner Kunst und seinem Leben oft verbarg.
Gottfried Benn, Nele Benn: Briefwechsel 1930–1956. Herausgegeben von Holger Hof und Stephan Kraft. Wallstein/Klett-Cotta, 702 S., 66 Euro
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke