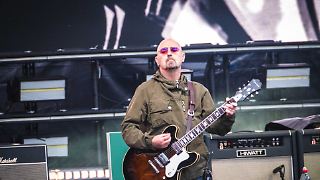Zweifellos leben wir in einer Ära der Empfindsamkeit und des Mitgefühls. Dazu muss man sich einmal durch die Popcharts mit Coldplay oder Taylor Swift hören oder auch einen ganzen Fernsehnachmittag mit tränenreichen Reality-Shows zubringen. Es reicht zur U-Bahn zu laufen und sich von den werbenden Hilfsorganisationen auf die furchtbaren Schicksale Entrechteter oder Hungernder, leidender Kinder oder gequälter Tiere hinweisen zu lassen. Anlässe zu Gefühlsausbrüchen bieten die Nachrichten täglich schon genug, doch auch die Welt der Fiktionen hält Einladungen zur Anteilnahme bereit.
Dabei muss es nicht immer gleich der Untergang der „Titanic“ oder der tödliche Autounfall eines Fußballstars sein, schon das Schluchzen der Verlierer in einem Endspiel wird offen und ohne jede Scheu vor der Ausstellung von Gefühlen zelebrierte und wirkt seinerseits emotional auf den Betrachter zurück. Es ist zwar immer noch eine Nachricht wert, wenn Politiker in der Öffentlichkeit mit den Tränen kämpfen (wie neulich Friedrich Merz bei der Wiedereröffnung der Münchner Synagoge), aber eine Sensation ist das nicht mehr. Nicht nur Kinder, auch Erwachsene, ja auch Männer weinen.
Wechsel von Härte und Weichheit
Das war nicht immer so. Der britische Journalist Ferdinand Mount hat gerade auf Englisch ein Buch veröffentlicht, dass der Geschichte eines Gefühls nachgeht: „Soft. A Brief History of Sentimentality“ schlägt einen weiten kulturhistorischen Bogen vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Seine Hauptthese: Historisch wechseln sich Epochen der Gefühligkeit und solche von Härte, Kälte und tabuisierter Emotionalität ab. Gerade, so die Pointe des brillanten Werks, werden wir womöglich wieder Zeuge eines Umschlags, manche werden sagen: eines Rollbacks. Härte, Männlichkeit, maskenhaftes Verbergen von Gefühlen, Mitleidlosigkeit drohen wieder an die Stelle von Wärme, Mitgefühl und Anteilnahme am Schicksal benachteiligter oder unglücklicher Menschen zu treten.
Solche Ungerührtheit und Gefühlskälte habe einst große Zeiträume unserer abendländischen Geschichte regiert, so die Ausgangsthese Mounts. Das was er als die „erste sentimentale Revolution“ bezeichnet, habe sich im 12. Jahrhundert unserer Zeitrechnung zugetragen, mit dem Auftreten der Troubadoure in Südfrankreich und den großen Artusepen eines Chrétien de Troyes, dem „Erfinder der modernen Love Story“ (mittelhochdeutsche Fassungen wie die von Hartmann von Aue oder Wolfram von Eschenbach hat der frankophile Engländer Mount nicht im Blick, würden den Befund aber nur bestätigen).
Während zuvor (überwiegend männliches) Heldentum mit Schwert und Lanze regierte, kommt nun mit Tristan und Isolde oder von Lancelot und Guinevere eine völlig neue, und vom rein christlichen Ideal der Nächstenliebe radikal unterschiedene Emotionalität ins Spiel, das unsere Kulturgeschichte über viele Zwischenstufen (Richard Wagner!) bis heute prägt.
Liebeswahn und Liebesverlust, Leid und Leidenschaft, Sehnsucht und Trauer um den oder die verlorene(n) Geliebte(n), all das wurde in den Epen und den Minneliedern des Hochmittelalters in die kulturelle DNA der „westlichen“ Zivilisation eingespeist, um nie mehr ganz verloren zu gehen. Wohl aber, um zwischendurch immer wieder verdeckt zu werden – gewissermaßen dominiert von anderen Kulturgenen. Vor allem vom Erbe männlich-rationaler Selbstbeherrschung, den kriegerischen Narrativen von Tapferkeit und Härte, aber auch einer Philosophie, die das Verfolgen von politischen oder religiösen Idealen zum Hauptzweck des Menschen erklärt und alles andere als Schwäche abwertet. In diesen hochideologisierten Epochen wie etwa dem Zeitalter der Glaubenskriege in der frühen Neuzeit oder auch der Weltanschauungskämpfe zu Beginn des 20. Jahrhunderts mussten Gefühle zurücktreten, galten gar als Verirrung, als Hindernis.
Die zweite „Sentimental Revolution“ datiert Mount, literaturhistorisch traditionell, auf die Mitte des 18. Jahrhunderts: 1740 erschien mit Samuel Richardsons „Pamela oder die belohnte Tugend“ der erste bahnbrechende Roman einer Epoche, die man in Deutschland „Empfindsamkeit“ nennt. (Prägend war die auf Lessing zurückgehende Wortneuschöpfung „empfindsam“ als Eindeutschung des Titels von Laurence Sternes Roman „A Sentimental Journey“).
Notwendige Klärung der Begriffe
An dieser Stelle müssen wir einmal kurz auf die Begriffe eingehen: Das englische „sentimental“ ist eben nur manchmal direkt als „sentimental“ zu übersetzen, das im Deutschen einen abwertenden Beiklang hat. Im Englischen kann es das haben, dann ist sentimental praktisch synonym mit „kitschig“, „gefühlsduselig“ oder um ein schönes, altmodisches Wort zu nehmen: „rührselig“. Aber es kann eben auch positiv eher „gefühlsbetont“, „empfindsam“, eben „emotional“ oder „mitfühlend“ meinen. (Schillers Begriff „sentimentalisch“ als Gegensatz zu „naiv“ führt wieder in eine ganz andere Richtung, weil hier gerade die Reflexion ins Spiel kommt.)
Mount selbst hält es nicht so streng, er ist Essayist, kein Logiker. Grundsätzlich bedeutet für ihn „sentimental“ eine Priorisierung des Gefühls, der Passion, auch der „Compassion“, des Mitleidens, des „Soften“ eben, wie der Buchtitel sagt. Die breite, tränengetränkte Spur, die „Sentimentality“ durch die Kulturgeschichte zieht, führt einerseits über den Briefroman des 18. Jahrhunderts wie Rousseaus „Julie oder Die neue Heloise“ und, natürlich, Goethes „Leiden des jungen Werther“, den empfindsamen Roman der deutschen Literaturgeschichte schlechthin, bis zu Charles Dickens’ oder Victor Hugos herzerweichenden Sozialromanen.
Eine große Rolle spielt die Bildende Kunst, die Darstellung kranker oder armer Kinder oder Menschen auf dem Sterbebett, die unmittelbar an die Gefühle oder Gewissen des Betrachters appellieren. Das Modell der Pietà, der Beweinung Christi durch Maria, gibt hier ein bis in die Gedenkkultur des 20. Jahrhunderts weiterwirkendes Motiv vor. In Deutschland würde man etwa die Tradition einer Käthe Kollwitz nennen oder bei den großen Romanen Döblins „Berlin Alexanderplatz“ oder sogar noch Thomas Manns „Doktor Faustus“, man denke hier vor allem an den an Meningitis sterbenden, kleinen Jungen Nepomuk. Selbst der große Ironiker Mann wusste die Wirkung einer auf „Sentimentalität“ setzenden Erzählweise gezielt einzusetzen. Mitleiderregendes Geschichtenerzählen steht immer auch – und bis heute – unter dem Verdacht des Manipulativen, einer Spiel auf der „Klaviatur der Gefühle“, der „emotionalen Geiselnahme“.
Massenhafte Rührseligkeit
Ästhetisch setzte die Moderne dagegen die Abstraktion, das Experiment, die Übertonung des Formalen in der Kunst gegenüber den emotional aufrührenden, gesellschaftskritischen, empörenden Inhalten. Auch Bertolt Brechts „Episches Theater“ gehört zur antiemotionalen Gegenbewegung, die an den Verstand, nicht die Gefühle des Zuschauers appellieren will und deswegen statt auf Einfühlung und Identifikation auf Verfremdung und Distanz setzt. Auch dies ist eine Bewegung, die das Theater dann seit den 90er-Jahren im „Postdramatischen“ wieder nachvollzogen hat. Mounts Buch regt, auch wenn seine Beispiele überwiegend aus der britischen Kulturgeschichte stammen, auch zum Nachdenken über hiesige Strömungen an.
Mit der modernen Popmusik – sprich: mit den Beatles – setzt dann nämlich die dritte Phase der massenhaften Rührseligkeit ein und dabei geht es nicht nur um „Love, Love, Love“, sondern auch um Einsamkeit oder Trauer, um Elend und Armut. Man denke nur an „Eleanor Rigby“ oder an Terry Jacks „Seasons in the Sun“, an Don McLeans „American Pie“ oder Elvis’ „In the Ghetto“. „They Don’t Care About Us“ empörte sich Michael Jackson und alle zusammen sangen „We are the world/ We are the children“. Mit der weltweiten Diana-Mania, zu der Elton John „Candle in the Wind“ intonierte, schlug die Kultur der Sentimentalität spätestens in ein Stadium um, das zahlreiche Kulturkritiker auf den Plan rief.
Ausgestellte Gefühle galten als Heuchelei, als Fake, als Show vor großem Publikum. In Großbritannien war schon angesichts der Tränen des Fußballstars Paul „Gazza“ Gascoine bei der WM 1990 eine nationale Debatte über Männlichkeit und Gefühlskultur ausgebrochen. Heute würde man wohl Fußballer, die nach einem verlorenen K.o.-Spiel nicht weinen, wegen Gefühlskälte zum Psychiater schicken. Wer heute seine Emotionen verbirgt, darf sich dem „Spektrum“ zurechnen oder „neurodivers“ nennen, dann hat er selbst wieder Anspruch auf Mitgefühl.
Zweifellos gibt es aber auch die Tendenz, Empfindsamkeit heute durch (Über)-Empfindlichkeit zu ersetzen. Das ständige Verletztsein, das Snowflake-Hafte, das man auch in den übersensiblen Helden des 18. Jahrhundert findet, ist eigentlich das Gegenteil einer aufgeklärten Sentimentality, die sich zuallererst auf den Anderen, auf den Mitmenschen richtet. Solche Überempfindlichkeit bedroht den Kern des Sentimentalen ebenso wie seine Verleumdung durch die neuen Propagandisten der Härte.
Mit Blick auf die Gegenwart gibt Mount zu, das seine anfängliche Idee, eine Lanze für die (unter Intellektuellen, nicht in der Bevölkerung) schlecht beleumundete Emotionalität zu brechen, im Verlauf der Arbeit sich eher radikalisiert hat. Ist es etwa als heuchlerisch zu verurteilen, wenn sich Prominente heute gegen Landminen oder weiblich Genitalverstümmelung einsetzen? Sind Aktivisten für Inklusion oder gegen Rassismus selbstgerechte „Gutmenschen“? Nein, so Mount, das sich darin ausdrückende Mitgefühl ist das, was uns Menschen ausmacht, und es steht nicht im Gegensatz zum Verstand, auch wenn das superclevere Spötter stets behaupten: „Eine Träne“, so Mount, „ist eine Sache der Vernunft.“
So sind auch die neue Härte, die manche Manfluencer propagieren, oder der polemische Abschied von Engagement, etwa gegen Armut, Hunger und Vernachlässigung, keineswegs notwendige Kurskorrekturen nach einer Phase von übertriebenem Moralismus oder charakterlicher Verweichlichung. Wenn der Einsatz für benachteiligte Gruppen heute als „Wokismus“ desavouiert wird, dann ist das ein Verrat an der Idee, dass wir Menschen dazu geschaffen sind, das Leid anderer zu empfinden und es lindern zu wollen.
Am Ende des Buchs schildert Mount seine Ergriffenheit, als er bei den Pariser Paralympics im vergangenen Jahr das Finale im Blindenfußball sah. „Könnte es ein eindrucksvolleres Beispiel für menschlichen Einfallsreichtum geben oder für den Wandel in der Einstellung gegenüber Menschen mit Behinderungen – vom früheren Spott und der Vernachlässigung hin zu Respekt und aufrichtiger Bewunderung?“
Als „The milk of human kindness“ verspottete Shakespeares Lady Macbeth eine solche Geisteshaltung, als „Milch der frommen Denkungsart“, wie Schiller es übersetzte. Doch immer dann, so Mount, wenn in der Geschichte Mitleid, Menschenfreundlichkeit, eben Empfindsamkeit die Vorherrschaft hielten, dann gab es auch echte praktische Konsequenzen oder soziale Fortschritte. „Das weiche Wasser bricht den Stein“, sang einst eine Generation, die man damals gern als „Softies“ runtermachte. Doch Homo sapiens ist seinem Wesen nach ein eher sanfter Typ.
„Soft. A Brief History of Sentimentality“. Bloomsbury, 300 Seiten, ca. 20 Euro.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke