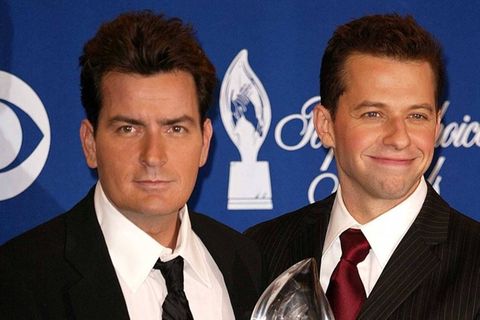Das Wiener Volkstheater wirkte in den vergangenen Jahren oft wie ein Heranwachsender mit den üblichen Problemen: geplagt von heftigen Identitätskrisen und auf der Suche nach einem Platz in der Theaterwelt, jugendliche Übersprungshandlungen inbegriffen. Mit Kay Voges, der als Intendant auf Anna Badora folgte, freundete man sich in der österreichischen Hauptstadt erst so richtig an, als sein Abschied nach Köln feststand – nach insgesamt nur fünf Jahren. Der von Voges forcierte Umbruch geriet oft zu nischig, befangen in pubertärer Provokationslust, irgendwie noch nicht richtig entwachsen.
Hört man sich heute um, was von der Voges-Zeit bleibt, wird immer wieder der wunderbare Ernst-Jandl-Abend „humanistää!“ von Claudia Bauer genannt, der mit seiner Einladung zum Theatertreffen auch das Bedürfnis nach überregionaler Bedeutung erfüllte. Und „Fräulein Else“ brachte Julia Riedler gerade erst eine Auszeichnung als „Schauspielerin des Jahres“ ein. Aber sonst? Gelang nicht viel. Beispielhaft dafür stand mit „Rom“ die als Sensation angekündigte Fortsetzung von Luk Percevals legendärem „Schlachten“, die – wie so vieles in der Zeit – im künstlerischen Nirgendwo versandete.
Und so staunt man nicht schlecht, wie erwachsen und reif sich das Volkstheater unter Voges’ Nachfolger Jan Philipp Gloger am vergangenen Freitagabend plötzlich präsentiert. „Ich möchte zur Milchstraße wandern“, die erste von drei Premieren zur Eröffnung, ist ein bunter und musikalischer Abend, der mit Leichtigkeit zwischen Albernheit und tiefem Ernst balanciert. Das ist mehr als nur eine schnöde Visitenkarte, die der aus Nürnberg gekommene Gloger mit diesem Abend abliefert. Wie hier Freude am Spiel und Lust aufs Publikum auf Mut zum Neuen treffen, wird in Erinnerung bleiben.
Gloger hat sich bewusst entschieden, nicht mit einem altbekannten Klassiker zu eröffnen – wie Stefan Bachmann bei seinem Amtsantritt am Burgtheater vor einem Jahr, mit einem trotz vieler Gespenster wenig begeisterndem „Hamlet“ –, sondern mit dem lange vergessenen Dramatiker Jura Soyfer. Man kann auch sagen: einem durch die Nazis verhinderten Klassiker. Soyfer, mit 26 Jahren im KZ gestorben, brachte in seinen Stücken die scharfe Gesellschaftskritik eines Karl Kraus mit der Unterhaltungstradition eines Johann Nestroy zusammen. Moderne Volksstücke, die auch heute noch funktionieren.
Was Gloger mit viel Slapstick auf die Bühne bringt, sind Menschen, die in ihren selbstgeschaffenen Vorstellungswelten gefangen sind – bis zur Selbstabschaffung. „Geh’n ma halt a bisserl unter“, heißt es in „Weltuntergang“, das mit zwei weiteren Stücken und kleineren Szenen zu einer Textcollage verbunden ist. Wenn auch alles vergeht, so nicht die Ideologie. „Astoria“ ist eine bitterböse Persiflage auf den modernen Staatsapparat mit seinen Mythen, „Vineta“ zeigt die Erfahrungs- und Geschichtslosigkeit als Fessel der Unfreiheit – eine tieftraurige und absurde Parabel à la Samuel Beckett über die verschwindende historische Vorstellungskraft der „Ausschussware Mensch“.
Ernste Dinge kann man auch lustig zeigen, das nimmt man aus dem Volkstheater mit, und manchmal geht es vielleicht auch gar nicht anders. Das Publikum, das sich vor der Vorstellung im Foyer drängte, feiert das großartige Ensemble mit Publikumsliebling Samouil Stoyanov, das in planetarischen Kostümen um die Rakete auf der Bühne wirbelt. Die bleibt zwar auf dem Boden, der Abend hingegen hebt ab. Und unterstreicht auch den Anspruch von Gloger, der politischen Komödie im Volkstheater eine Bühne zu bieten. Ein Auftakt, der hoffnungsfroh stimmt, davon möchte man in Zukunft gerne mehr sehen.
Den Abschluss des Eröffnungswochenendes macht Felicitas Brucker mit „Caché“ nach dem Film von Michael Haneke. Meisterhaft zeigt sie die geschlossene Welt eines wohlsituierten Ehepaares, die durch den Einbruch der Gewalt zerbricht. Die Wiederkehr des Verdrängten erschüttert die wohlige Wohnlandschaft in Türkis-Mint, in der überall Bildschirme mit Live-Video sind, nur die Kameras sieht man nicht. So entsteht ein bedrohliches Szenario der umfassenden und permanenten Beobachtung ohne Beobachter wie im digitalen „Überwachungskapitalismus“ (Shoshana Zuboff).
20 Jahre nach seiner Premiere in Cannes erweist sich „Caché“ als prophetische Vorwegnahme der heutigen Debatten über das verdrängte koloniale Erbe, das Obszöne des Bürgertums – hier im Wortsinn: außerhalb der Szene, wie einem das ausgesprochen clevere Bühnenbild von Viva Schudt vor Augen führt – und die pathologische Abwehr des Blicks in den eigenen Spiegel. Nicht zuletzt können sich die neuen Ensemblestars Sebastian Rudolph, Johanna Wokalek und Bernardo Arias Porras dem Wiener Publikum mit einer Glanzleistung vorstellen. Und auch hier wird die Neugier auf mehr geweckt.
Gelingt es Gloger, auch mit den nächsten Premieren an die Eröffnung anzuschließen, wird man in Wien über das Volkstheater wohl bald sagen müssen: Da schau her, das ist aber schnell groß geworden! Zudem das über allem thronende Burgtheater auffällig schwächelt, zu brav und uninspiriert wirkt. Dass Bachmann dort in seiner zweiten Spielzeit noch zwei alte Inszenierungen von seiner vorigen Station in Köln übernimmt, wirkt nicht mutig oder der Zukunft zugewandt. Da wird man eher das neue Volkstheater im Blick behalten müssen. Es könnte sein, dass die Zeit der Identitätskrise vorbei ist.
„Ich möchte zur Milchstraße wandern“ und „Caché“ laufen am Wiener Volkstheater
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke