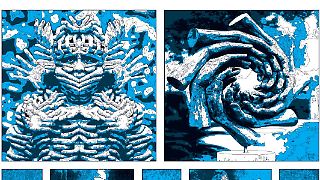Wo in der deutschsprachigen Erzählliteratur des 19. Jahrhunderts gibt es Patchworkfamilien? Wo kommen Schwarze vor, die Deutsch mit norddeutschem Einschlag sprechen, weil sie schon in Bremen geboren wurden? Wo spielen Surinam, Sumatra oder ein fiktives afrikanisches Mondgebirge als Bildungserlebnis für junge, neugierige Männer eine Rolle?
Nicht bei Theodor Storm jedenfalls und in seiner „grauen Stadt am Meer“, will sagen Husum. Auch nicht bei Gottfried Keller, der ebenfalls nur geringfügig über seinen Zürcher Tellerrand hinausschaute, nachdem ihn Berlin so überfordert hatte. Und sogar beim urbanen Theodor Fontane, der doch immerhin postulierte: „Hinter den Bergen wohnen auch Menschen“ und einen Zusammenhang zwischen dem Stechlinsee und fernen Erschütterungen in der Südsee herstellte, haben wir kaum einen Abglanz der sich langsam globalisierenden, rapide modernisierenden Welt im Umbruch, die seit den 1870er-Jahren das ruhelose Deutsche Reich zu kennzeichnen begann.
Aber bei Wilhelm Raabe, da finden wir das alles! Zu Lebzeiten (1831 bis 1910) verkannt als Gemütsonkel im Krähwinkel, lebt er im Unterholz der kollektiven Erinnerung fort mit Romantiteln, die ihn gnadenlos in die Beschaulichkeitsecke abgedrängt haben, als da wären „Die Chronik der Sperlingsgasse“ oder „Unseres Herrgotts Kanzlei“, um nur zwei zu zitieren. Und ist nicht auch so manches von seinen rund siebzig Erzählwerken vorab in der „Gartenlaube“ erschienen? Das kann uns dann ja wohl heute nicht mehr viel sagen! So lautete lange das gängige Vorurteil.
Allerdings hatte Raabe immer seine Fans. Das waren Leute, die sich an seinen verschrobenen Figuren erfreuten. An den vertrackten Plots, bei denen man lange nicht versteht, wovon überhaupt die Rede ist, bis sich die Geschichten dann als immer spannender, auch unheimlicher und abgründiger, entpuppen.
Fans hatte Raabe aber vor allem bei denjenigen, die zu schätzen wissen, dass dieser Autor wie kein anderer, der dem poetischen Realismus zuzuordnen ist, gewitzt unterläuft, was man in der Germanistik „idealistische Bedeutungsproduktion“ nennt. Seit der Klassik und bis in unsere Gegenwart mit ihrem politisch korrekten „Engagement“ ist diese nervtötende Bedeutungsproduktion etwas, was die deutsche Literatur für frivolere Gemüter oft so schwer erträglich macht.
Raabe kannte natürlich das deutsche Streben nach dem Idealen, Höheren. Er achtete es auch. Denn es gibt ja Ideale, die zu verteidigen sich lohnt: Anstand, Mitgefühl, Herzensbildung beispielsweise. Aber amüsanter war und ist natürlich immer zu schildern, wie Ideale zur Fassade verkommen, nur vorgeschützt sind. Und das war seine Sache. Dem diente sein Schreiben. Nicht auf besserwisserische Manier mit erhobenem moralischem Zeigefinger. Sondern subtil, ironisch (das Modewort „subversiv“ überlassen wir den Zeitgeistsurfern!) und stets mit jenem Humor, der zur Versöhnlichkeit neigt.
Der andere Wilhelm Raabe
Dabei kamen Dinge in den Blick, die in der Rezeption lange ausgeblendet wurden. Aber eine neue Ausgabe von Raabes Werken, die jetzt im Wallstein-Verlag bereits bis Band vier gediehen ist, rückt gerade sie in den Mittelpunkt, bereit und willens, auf diese Weise einen Raabe für unsere Zeit zu präsentieren. Von daher ist die bisherige Auswahl aus dem Gesamtwerk dieses Vielschreibers bereits Programm. Es geht also nicht los mit Raabes historischen Romanen, auch nicht mit seinen melancholischen Alterswerken, die übrigens zum Schönsten gehören, was das 19. Jahrhundert hervorgebracht hat: „Die Akten des Vogelsangs“ von 1896 etwa sind Raabes unübertroffenes Meisterwerk.
Nein, was das Herausgeberteam um Moritz Baßler, Professor für Neuere deutsche Literatur an der Universität Münster, interessiert, ist Raabes Zeitliteratur. Texte, die in den Jahren nach der Reichseinigung von 1871 entstehen, eine Zeit, die von Industrialisierung, gesellschaftlichen Verwerfungen, auch schon Umweltverschmutzung, aber auch von einem großen Aufbruchs-Elan gekennzeichnet ist. Raabe verbrachte sie, nach Stationen in Holzminden, Berlin, Magdeburg, Stuttgart (wo 1862 bis 1870 seine literarische Karriere Fahrt aufnahm), überwiegend in Braunschweig. Dort ist er dann auch gestorben.
Die vier Romane, mit denen die Ausgabe startet, heißen „Meister Autor“, „Fabian und Sebastian“, „Unruhige Gäste“ und „Der Lar“. Sie gehören zu seinen weniger bekannten, bereits zu Lebzeiten unterschätzten Arbeiten. Sie erschienen 1873, 1882, 1885 und 1889. „Einen großen Zeitroman schreibe ich nicht“, hat Raabe einmal trotzig zu einem Freund gesagt, als wolle er sich absetzen von damals populären Schriftstellern wie Karl Gutzkow oder Friedrich Spielhagen. Er beharrte auf seinen skurrilen, anspielungsreichen, aus- und abschweifenden Eigentümlichkeiten, die seine Arbeiten so unverwechselbar machen.
Aber sie greifen eben doch in ihrer spezifischen Weise Themen wie die damals viele traditionale Lebenswelten verändernden Stadterweiterungen und -umbauten auf („Meister Autor“). Oder die neue touristische Stadtflucht in angebliche ländliche Idyllen, die sich dann als ganz und gar nicht intakt erweisen („Unruhige Gäste“). „Fabian und Sebastian“ wiederum spielt in einer Schokoladenfabrik und führt auch stumpfsinnige Herstellungsprozesse vor, die vor allem junge Frauen proletarisieren und pauperisieren. Dafür wird jedoch am Schluss die Nichte von Fabian und Sebastian Firmenchefin.
„Der Lar“ schließlich verwandelt den romantischen Topos von den zwei Gesellen, die auf naive Weise optimistisch ins Leben starten, in eine Desillusionierungsgeschichte, in der die Größenfantasien eines angehenden Malers und eines Wissenschaftlers in spe alsbald zerplatzen. Beide richten sich schließlich in neuen Berufen ein, die damals aufkamen, wie der Leichen- und Polizeifotograf beziehungsweise der Lokalreporter.
Einer der beiden hoffnungsvollen Jünglinge („der schöne Bogislaus“) ist klar als homosexuell lesbar (zumal er den schwulen Dichter Platen liebt; „der weiß, wie einem zumute ist“). Am Ende aber integriert sich der schöne Bogislaus in die Kleinfamilie, die sein Reporterfreund mit einer Klavierlehrerin gründet und zu der schon bald ein Kind gehört. Nimmt man noch den Paten des Lokaljournalisten hinzu, einen ehemaligen Tierarzt, für den ein ausgestopfter „Lar“, also ein Affe, Hausgott und Symbol für das „Affentheater“ der Welt wird, so hat man die erste Patchworkfamilie, besser gesagt die erste „alternative community“ der deutschen Literaturgeschichte beisammen, die nicht aus Not, sondern aus freiem Entschluss entstanden ist und der es auch noch gut geht. Denn der Affe ist nicht zuletzt mit Wertpapieren ausgestopft …
„Der Lar“, aber auch die anderen drei Titel werden in dieser Ausgabe sorgfältig kommentiert, der stoffliche Hintergrund mit viel Liebe zum kulturgeschichtlichen Detail erschlossen. Leider wird die originale Textgestalt rekonstruiert („Der weiß, wie Einem zu Muthe ist“), was denn doch eine zu tiefe Verbeugung vor Raabes Marottenhaftigkeit ist. Problematisch sind zum Teil auch die Nachworte. Ihr Ehrgeiz, alles restlos zu erklären, verwechselt den künstlerischen Prozess mit einer Patience, die nur dann abgeschlossen ist, wenn sie „aufgeht“. Gegendert wird leider auch, und nicht minder zeitgeistopportunistisch verhält sich ein Herausgeber, wenn er behauptet, „Der Lar“ sei, ach, wie toll, ein „Antibildungsroman“, und „Individualität“ werde hier Gott sei Dank als „Illusion“ entlarvt.
Das Gegenteil ist aber der Fall, nur wird bei Raabe in den Bildungsroman eben auch ein pragmatisches Lebenskonzept integriert, und die Individualität seiner Figuren könnte farbiger und kraftvoller gar nicht sein. Aber wer Raabe liest, wird schnell immun gegen linke akademische Deutungsschablonen. Insofern schaden sie nicht. Zumal sie ja einem guten Zweck dienen: einem Autor wieder den Platz zu sichern, der ihm gebührt. Im literarischen Kanon unserer Nation.
Wilhelm Raabe: „Fabian und Sebastian“, „Unruhige Gäste“, „Der Lar“, „Meister Autor“. Wallstein, 288, 234, 287, 245 Seiten, je 26 Euro.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke