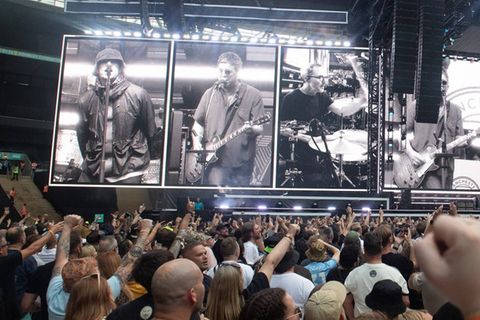Der niederländische Schriftsteller Abdelkader Benali blickt nachdenklich auf eine großformatige Schwarz-Weiß-Aufnahme. „Schauen Sie, dieses Foto von der Familie, die den großen Wagen belädt. Das ist eine türkische Familie aus dem Rotterdamer Stadtteil Crooswijk – da ganz in der Nähe bin ich aufgewachsen. Die Frage ist: Fahren sie weg oder kommen sie gerade an?“
Am geöffneten Kofferraum eines Autos lacht ein Mann in die Kamera, zu seinen Füßen stehen zwei Koffer, ein Autoreifen und ein Karton. Zwei kleine Jungen beobachten die Szene vom Gehsteig aus. „Der Fotograf war Robert de Hartogh, ein Rotterdamer, der vor ein paar Jahren verstorben ist. Ein Freund von mir“, erzählt Benali, Jahrgang 1975.
„In den 1970er-Jahren, nach seinem Abschluss an der Kunstakademie, hatte er eine türkische Freundin. Durch sie kam er dazu, die türkische Gemeinschaft zu porträtieren. Für mich ist er der Fotograf des anderen, multikulturellen Rotterdam.“ Er zeigt auf das Bild. „Großartig, dieser amerikanische Straßenkreuzer.“
Wir befinden uns im Erdgeschoss von Fenix, dem neuen Rotterdamer Museum zur Geschichte der Migration. Die Eröffnung im Mai durch Königin Máxima – selbst argentinische Einwanderin – wurde in den Niederlanden als kultureller Höhepunkt gefeiert. Die Reaktionen der Kunstkritik waren gemischt. Die Tageszeitung „de Volkskrant“ fand die Sammlung „überzeugend“, das „NRC Handelsblad“ hingegen nannte sie „überbordend“.
In einem Punkt jedoch herrschte Einigkeit: Der Ort ist spektakulär. Fenix ist untergebracht in einer ehemaligen Lagerhalle im historischen Hafenviertel von Rotterdam. Die Halle, genannt „San Francisco“, umfasst 16.000 Quadratmeter und war bei ihrer Fertigstellung 1922 die größte ihrer Art weltweit. Das chinesische Architekturbüro MAD Architects unter Ma Yansong hat das Gebäude saniert und neu gestaltet. Neben dem Museum beherbergt es den öffentlichen Begegnungsraum „Plein“ (Platz), ein Café, eine Bäckerei des türkischen Sternekochs Maksut Aşkar sowie eine italienische Eisdiele.
Blickfang ist der sogenannte Tornado – eine glänzende, doppelt gewundene Treppe, die sich vom Atrium aus emporwindet und auf ein Panoramadach mit Blick über Rotterdam und die Maas führt. Außen mit Edelstahlplatten verkleidet, wirkt die Konstruktion wie eine überdimensionierte Wasserrutsche.
Doch dorthin sind wir noch nicht vorgedrungen. Benali, unser persönlicher Reiseführer, führt uns von der Fotoausstellung „The Family of Migrants“ weiter ins sogenannte „Kofferdoolhof“ (Kofferlabyrinth). Der Schriftsteller und Theatermacher, dessen Debütroman „Hochzeit am Meer“ (1998) auch in deutscher Übersetzung erschienen ist, war in den vergangenen zweieinhalb Jahren als Kurator für Fenix tätig.
Seine Biografie prädestinierte ihn für diese Aufgabe: Benali kam als vierjähriger Junge mit seiner Familie aus Marokko in die Niederlande und wuchs in Rotterdam auf. Heute lebt er in Amsterdam und zeitweise im marokkanischen Tanger. In der kommenden Theatersaison geht er mit einem Stück über den Fall von Granada – der Hauptstadt des maurischen Königreichs im mittelalterlichen Spanien – auf Tournee durch die Niederlande.
Benali schlendert durch das Labyrinth aus zweitausend gestapelten Koffern, die sich zu etwa anderthalb Meter hohen Wänden türmen. Es sind gestiftete Exemplare – von Überseekoffern bis zu kleinen Reisetaschen – aus Ländern wie Kanada, Südafrika oder Neuseeland. Benali gibt sich als Sammler zu erkennen: „Wenn man einen guten Koffer hat, kann man die ganze Welt bereisen. Ich bin ein unruhiger Mensch, ständig unterwegs. So ein Koffer ist für mich eine Art, diese Rastlosigkeit zu kanalisieren.“
Er fingert an einem Koffer in der Wand. „Das darf man eigentlich nicht, aber nichts klingt schöner als dieses Geräusch.“ Zwei Schnappverschlüsse klicken. „Das löst Gänsehaut bei mir aus. Es bedeutet: Jetzt bist du angekommen. Entspannung. Vielleicht liegt das an meiner Herkunft als Migrantenkind.“ Auf dem Weg zur Treppe erklärt Benali, warum er Fenix für so bedeutsam hält: „Das Thema Migration wird heute zu 90 Prozent von der Politik bestimmt, aber die historische Dimension ist kaum bekannt. Migration ist menschlich – und uralt.“
Nicht zufällig wurde das Museum auf der Rotterdamer Halbinsel Katendrecht errichtet. Von ihren umliegenden Kais sind über Jahrhunderte Millionen Menschen aufgebrochen oder angekommen. Auf der gegenüberliegenden Seite des Wassers steht das Hotel New York – einst Hauptsitz der Holland-Amerika-Linie (HAL), mit deren Schiffen unter anderem Albert Einstein, der Maler Willem de Kooning und der Künstler Max Beckmann den Atlantik überquerten. In der heutigen Fenix -Halle wurden einst die Güter der HAL be- und entladen.
Auch die Herkunft des Museums ist kein Zufall: Die Rotterdamer Familie Van der Vorm, unter anderem durch die HAL zu Vermögen gelangt, betreibt eine Stiftung, die Hunderte Millionen Euro in die Kultur der Hafenstadt investiert. Katendrecht wird derzeit umfassend umgestaltet: Noch in diesem Jahr zieht das Nederlands Fotomuseum in ein benachbartes Lagerhaus – ebenfalls mit Unterstützung der Familie Van der Vorm.
Die Stufen der Tornado-Treppe knarzen kein bisschen. Wir erreichen die erste Etage, wo sich die größte Ausstellungshalle von Fenix befindet. Dort ist die Eröffnungsausstellung „Alle richtingen“ (Alle Richtungen) zu sehen – mit über 150 Werken bekannter und weniger bekannter Künstler. Die Exponate wurden vom Museum gekauft, eigens in Auftrag gegeben oder als Leihgaben bereitgestellt.
Ergänzt wird die Schau durch historische Objekte mit Bezug zur Migration. Das Spektrum reicht von visuell zugänglichen Arbeiten bis hin zu schwierigen Themen – genau das, was Museumsdirektorin Anne Kremers nach eigener Aussage erreichen möchte. So sind auf der ersten Etage unter anderem ein Stück der Berliner Mauer zu sehen sowie ein Boot, mit dem nordafrikanische Geflüchtete 2022 auf Lampedusa landeten – ein Geschenk des italienischen Zolls.
Ausgestellt ist auch ein Miniaturporträt des Rotterdamer Humanisten Erasmus, um 1532 von Hans Holbein dem Jüngeren gemalt, sowie ein lebensgroßes Stoffmodell eines New Yorker Stadtbusses, das Besucher betreten können: „The Bus“ (1995) von Red Grooms. Das wohl teuerste Werk ist das Gemälde „Man in Wainscott“ (1969) des niederländisch-amerikanischen Künstlers Willem de Kooning – im vergangenen Jahr bei Christie’s für fast 8,7 Millionen Dollar ersteigert.
Benali führt uns zu einer schlichten Vitrine. Darin liegt ein kleines Heft, kaum größer als eine Handfläche, mit vergilbten Seiten. Benali erzählt, wie er es dem Stadtführer Frank Kanhai in Den Haag abgeluchst hat. Das Heft gehörte Kanhais Tante aus Surinam, die nach der Unabhängigkeit der früheren niederländischen Kolonie 1975 zu ihm in die friesische Stadt Drachten gezogen war.
Ab und zu reiste sie nach Rotterdam, um Lebensmittel aus ihrer Heimat zu kaufen – und Kanhai gab ihr dieses Heft für unterwegs mit. „Lieber Busfahrer oder Kontrolleur“, liest Benali vor, „meine Tante spricht kein Niederländisch. Sie möchte nach Rotterdam und zurück, um surinamische Lebensmittel zu besorgen. Können Sie ihr helfen?“
Begegnungen im Migrationsmuseum Fenix
Wenig später stehen wir vor zwei Audiokassetten. „Nach so was haben wir lange gesucht“, sagt Benali. „Wie viele andere Migranten haben auch meine Eltern in den 1970er- und 1980er-Jahren Kassetten besprochen und in ihre Heimat geschickt. Sie erzählten, wie es ihnen ging: Wir vermissen euch, die Arbeit geht von dann bis dann, wir schicken bald Geld – solche Botschaften.“
Aus einem Lautsprecher erklingt der Gesang einer Frau – der Mutter von Yeter Akin. Akin, die ihre Kassetten dem Fenix als Leihgabe überließ, blieb als Kind in einem Dorf in Ostanatolien zurück, während ihre Eltern in den Niederlanden arbeiteten. Benali: „Viele Menschen wollten ihre Kassetten nicht hergeben, weil der Inhalt so persönlich ist.“
Wir gehen an zwei Fibeln vorbei – traditionellen Gewandnadeln, gefertigt von einem Goldschmied in Marokko. Eingearbeitet sind niederländische Guldenmünzen. „Die haben marokkanische Arbeitsmigranten mitgebracht und ihren Familien geschenkt“, erklärt Benali. Er bleibt bei einer Fotoserie des schweizerisch-ägyptischen Künstlers Marwan Bassiouni stehen.
Auf den Bildern sieht man Fenster in Moscheen oder Migrantenwohnungen, dahinter typische niederländische Straßenszenen. „Eine spannende Kombination. Das ist die doppelte Perspektive, die auch ich habe: ein eigenes Zuhause, das Zuhause deiner Eltern – aber wenn du hinausblickst, siehst du die Niederlande.“
Wir erklimmen das letzte Stück der Tornado-Treppe. Nach 226 Stufen und 550 Metern endet sie auf einer Plattform mit Rundblick über die Maas-Metropole. Die Erasmusbrücke, der Euromast-Turm, das von Rem Koolhaas entworfene Bürohochhaus „De Rotterdam“.
Benali blickt über das Wasser, die Augen halb geschlossen gegen die gleißende Sonne. „Diese Stadt erfindet sich ständig neu, immer mit dem Blick nach vorn. Deshalb ist es wichtig, dass es einen Ort wie Fenix gibt, an dem auch zurückgeschaut wird – auf die Geschichte. An dem Menschen einander begegnen und im Flüsterton über das sprechen, was ihnen lieb ist. Denn Orte, an denen sich Menschen bekämpfen, haben wir schon genug.“
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke