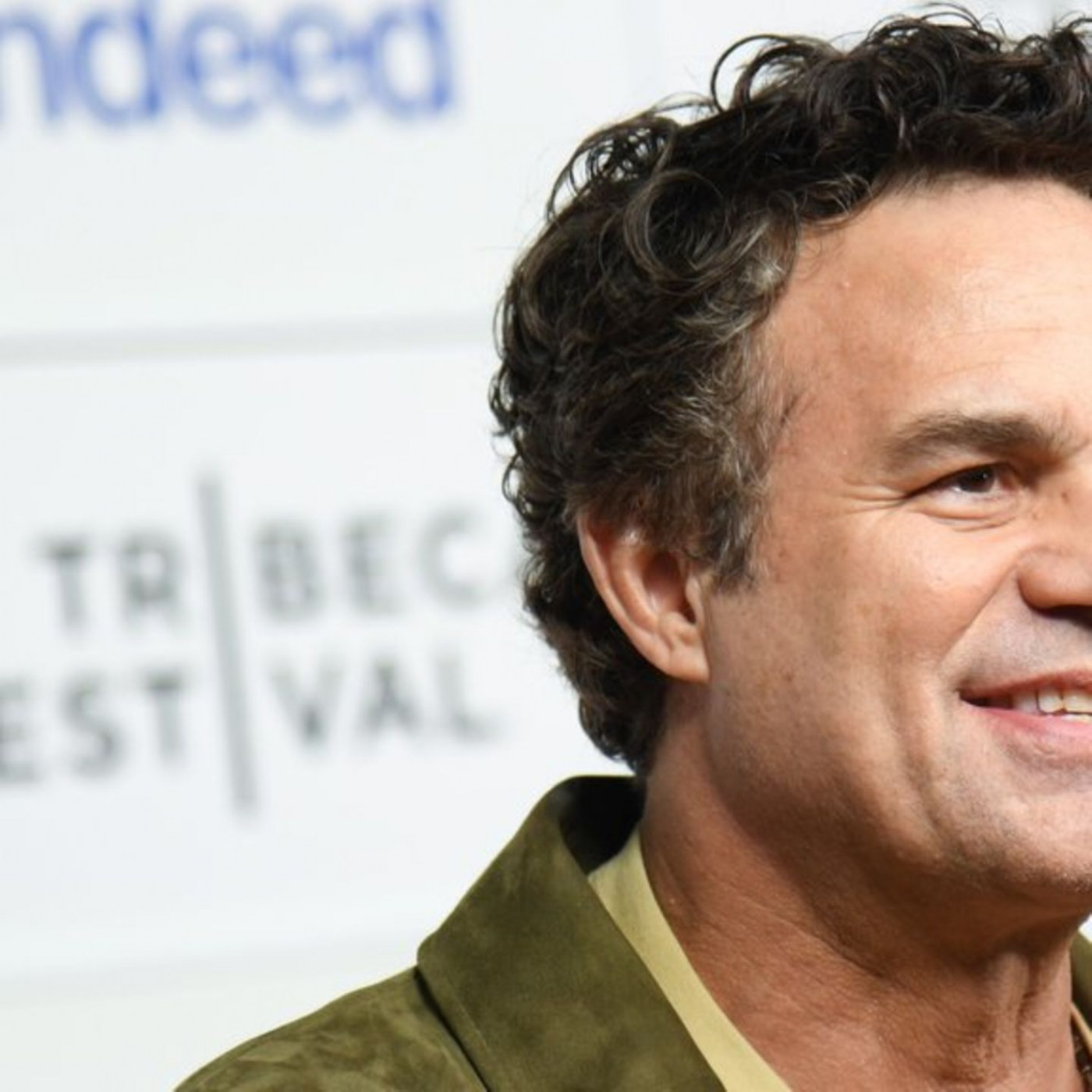Heinrich von Kleists „Der zerbrochene Krug“ spielt Ende des 17. Jahrhunderts im fiktiven Ort Huisum in den Niederlanden. Den Dorfrichter Adam trifft sein Schreiber namens Licht eines Morgens perückenlos und mit verschrammtem Kopf an. Ein schlechter Start in einen Gerichtstag. Zu allem Unglück kündigt sich der neue Gerichtsrat Walter an, der inspizieren will, ob in der dörflichen Amtsstube alles zum Rechten ist. Dass es in Huisum eher liederlich zugeht, zeigt, dass nun emsig allerlei Würste und Flaschen aus den Gerichtsräumen entfernt werden müssen. Barhäuptig muss Adam dann unter dem strengen Blick des hohen Gastes die erste Verhandlung des Tages führen. Es geht um den titelgebenden Krug, zerdeppert, wie die Klägerin Frau Marthe meint, von Ruprecht, dem Verlobten ihrer Tochter Eve. Dass der Richter sich in diesem Prozess höchst eigenartig verhält, lässt bald einen Verdacht aufkeimen: Ist Adam etwa ein besonders hanswurstiger Vetter des König Ödipus?
Tatsächlich ist Kleists Lustspiel wie die Tragödie von Sophokles ein „analytisches“ Drama: Es handelt von einem Täter, der die eigene Tat aufklären muss. Im Verlauf des Prozesses wird nämlich klar, dass des Dorfrichters abendliches Stelldichein mit Eve zum Bruch des Krugs geführt hat. Adams widersprüchliche Auskünfte zum Verbleib seines Kopfputzes deuten früh darauf hin: Dem Rat sagt er, er sei bei der Bibellektüre der Kerzenflamme zu nahe gekommen, worauf seine Perücke in Flammen aufgegangen sei. Hatte er seinem Schreiber aber nicht ein ganz anderes Ammenmärchen aufgetischt? In seine Perücke, „hätt die Katze heute morgen / Gejungt, das Schwein! /Sie läge eingesäuet / Mir unterm Bette da“.
Das müsste doch auch politisch engagierte junge Menschen amüsieren. Erinnern solch kreative Ausreden nicht an Ausflüchte von deutschen Spitzenpolitikern – an den Klassiker „ich kann mich nicht erinnern“ genauso wie an das überraschendere „mein Bruder hat’s geschrieben“ – und verweisen sie locker auf die Ränge? Dennoch ist Kleists Klassiker, 1808 in Weimar vom gebürtigen Frankfurter Johann Wolfgang Goethe uraufgeführt, heute für die Frankfurter Schüler-Union ein alter Zopf. Sie empört, dass Kleists Stück im Abiturpensum 2027 Georg Büchners „Woyzeck“ ersetzen soll, ein Dramenfragment, begonnen 1836, dessen Hauptfigur kurioserweise den Sohn eines Leipziger Perückenmachers zum historischen Vorbild hat. Kleists Komödie werde, so die Schüler, „eindeutig nicht den Ansprüchen der Oberstufe gerecht“.
Dass konservativer Polit-Nachwuchs der Kleistschen Komödie ausgerechnet ein Stück Büchners vorzieht, der den Palästen den Krieg erklärte, könnte in diesen Zeiten erfreuen. Verrät es doch die Einsicht, dass Literatur nicht auf die politischen Ansichten ihres Schöpfers reduziert werden darf. Ihre Argumente könnten die Schüler aber noch schärfen. Einen Kollateralnutzen hat der Frankfurter Aufstand im Deutschunterricht in jedem Fall. Denn Literatur kann nur gewinnen, wenn über sie gestritten wird.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke