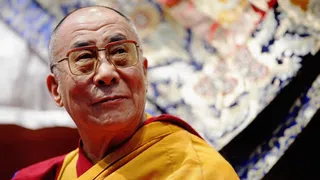Wie sie sich da gegenübersitzen in der dunklen Baracke – der japanische Offizier und der australische Militärarzt – kommt einem Leser Walter Benjamins die berühmte siebte These „Über den Begriff der Geschichte“ in den Sinn. Da heißt es, noch berühmter: „Es ist niemals ein Dokument der Kultur, ohne zugleich ein solches der Barbarei zu sein.“
Denn der Japaner hat dem Australier erklärt, auch das britische Empire und der zivilisatorische Fortschritt, den es bis in fast jeden Winkel des Erdkreises gebracht habe, seien auf Gewalt, Ausbeutung und Zerstörung gebaut – nicht nur das, was die japanische Armee hier im Dschungel betreibt. Was sie betreibt? Sie lässt eine Eisenbahntrasse durch den thailändischen Urwald schlagen – unter hohem Verschleiß menschlichen Lebens. Es ist das Leben australischer Kriegsgefangener, deren ranghöchster Vertreter der junge Arzt ist.
Dass das eine das andere nicht rechtfertigt, dass es eine Sphäre der Barbarei gibt, die sich nicht relativieren lässt, nicht einmal durch andere Menschheitsverbrechen – das ahnt man schon früh in der fünfteiligen australischen Serie „The Narrow Road to the Deep North“. Sie läuft unter Regie von Justin Kurzel („Macbeth“, „Assassin’s Creed“) bei Sky/Wow und basiert auf Richard Flanagans 2014 mit dem Booker Prize ausgezeichneten Roman (dt.: „Der schmale Pfad durchs Hinterland“).
Anfangs sitzt Dorrigo Evans – gespielt als junger Mann von Jacob Elordi („Euphoria“, „Saltburn“), als gealterter, hochdekorierter Veteran und Starchirurg von Ciarán Hinds („Belfast“) – in seinem luxuriösen Domizil aus Beton und Glas einer Journalistin gegenüber. Als sie ihn auf Hiroshima und Nagasaki anspricht, wird er ungehalten, um nicht zu sagen: feindselig. Denn die Bomben bedeuten dem lebenslang Traumatisierten offenbar nichts, angesichts dessen, was er selbst durchlitten und überlebt hat.
Die Serie arbeitet auf mehreren Zeitebenen. In der jüngsten, angesiedelt wohl in den 1980er-Jahren, wird Evans anlässlich der Veröffentlichung von Zeichnungen eines im Dschungel verstorbenen Kameraden von Erinnerungen heimgesucht – an das Martyrium in der Gefangenschaft, aber auch an die große Liebe seines Lebens: Amy. Er lernte sie kurz nach der Verlobung mit Ella kennen, jener Frau, die ihn bis ins Alter begleitet. Doch nicht nur Ella steht dieser Liebe im Weg – und nicht nur der Umstand, dass Dorrigo bald in den Pazifik abkommandiert wird. Amy ist verheiratet – mit Dorrigos Onkel.
Der einsamste Mensch der Welt
Die Szenen der Zwangsarbeit an der sogenannten Thailand-Burma-Eisenbahn, die zwischen 1943 und 1945 zwischen Ban Pong in Thailand und Thanbuyzayat in Burma verkehrte, bilden die nächste Zeitebene. Trotz direkter Verknüpfung mit Dorrigos Vierecksgeschichte (Neffe – Tante – Verlobte – Krieg) steht sie als dunkler Block im Zentrum der Serie, die permanent zwischen Liebe, Alter und Todeszone pendelt. Der Stoff ist bekannt, auch filmisch. David Leans Klassiker „Die Brücke am Kwai“ erzählt davon, basierend auf Pierre Boulles Roman. Auch der deutlich brutalere „To End All Wars“ („Die wahre Hölle“, 2001) greift das Thema auf – ebenfalls basierend auf authentischen Erinnerungen. Flanagan wiederum hat in seinem Roman Erlebnisse seines eigenen Vaters verarbeitet.
Kaum erträglich sind die Gefangenenszenen hier. Kurzel erspart dem Zuschauer wenig: die Amputation eines Beins bei vollem Bewusstsein, eine rituelle Enthauptung, die markerschütternde Prügelstrafe, bei der ein Kamerad sterbend nach seiner Mutter ruft. Dorrigos Gespräche mit den japanischen Offizieren kreisen um bessere medizinische Versorgung, um Ruhepausen – stets vergebens. In der fünften Folge muss er Kameraden für ein Himmelfahrtskommando auswählen. Später wird ihm Ella sagen, er sei der einsamste Mensch der Welt. Man glaubt es ihr.
Die sogenannte Todeseisenbahn ist hier in düsteren Farben gezeichnet. Es herrscht Finsternis, das Sounddesign – voller unheimlicher, organischer Geräusche – trägt ebenso zur Atmosphäre bei, wie die betont langsame Inszenierung: Sie spiegelt nicht nur den mühseligen Fortschritt der Arbeit, sondern macht die Ausweglosigkeit der Gefangenen fast physisch spürbar.
Und doch krankt der unbedingte Wille zur visuellen Kraft an Überstilisierung. Massenszenen – etwa beim Transport in Eisenbahnwaggons oder beim Hauen durch Stein und Gestrüpp – wirken, als hätte Instagram einen Sebastião-Salgado-Filter entwickelt, den Kurzel nun effektheischend über alles legt. Auch die tragische Liebesgeschichte zwischen Neffe und Tante kommt überästhetisiert daher – als sei sie eine Calvin-Klein-Kampagne in Pastell. Es fällt schwer, sie als das zu erkennen, was sie sein soll: der emotionale Bruch, der Dorrigo zerstört, noch bevor er in Thailand durch die Hölle geht.
Dass der Krieg dem Menschen die Fähigkeit nimmt, sich mitzuteilen, hat Walter Benjamin ebenfalls geschrieben. Am Ende von „The Narrow Road to the Deep North“ scheint sich Dorrigo Evans ein wenig von dieser Stummheit gelöst zu haben. Der Serie, die seine Geschichte erzählt, gelingt das nicht in vollem Maße. Sie erzählt zu wenig, setzt zu sehr auf Stimmung, Grauen, Schock. Vielleicht lässt sich von Traumata dieser Art aber auch gar nicht anders handeln.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke