Der Haushalt für 2025 ist beschlossen. Mehr als 500 Milliarden Euro will der Finanzminister ausgeben - und mahnt dennoch alle zum Sparen. Wie groß sind die Spielräume im Sozialstaat?
Mit etwa 190 Milliarden Euro entfällt mehr als ein Drittel des Haushalts auf das Ministerium für Arbeit und Soziales. Für die Grundsicherung für Arbeitssuchende sind knapp 52 Milliarden Euro eingeplant. Ein zu großer Posten für den Bundeskanzler. "Niemand fällt in unserem Land in die Armut, weil er arbeitslos wird", erklärt Friedrich Merz in dieser Haushaltswoche. Das sei eine große Errungenschaft unseres Sozialstaates. "Und gerade weil wir diesen Kern des Sozialstaates erhalten wollen, werden wir das bisherige Bürgergeld zu einer neuen Grundsicherung grundlegend ändern müssen", so Merz.
Die Reform der Bürgergelds soll in zwei Schritten kommen. Ein erster Teil innerhalb der nächsten Wochen, ein zweiter Teil im kommenden Jahr, wenn die Ergebnisse der Kommission für Sozialstaatsreform vorliegen. Ein leichtes Unterfangen wird das Projekt nicht.
"Die Bürgergelddebatte läuft stark über Stereotype", sagt Arbeitsmarktforscher Enzo Weber. Wirklich große Summen in der Grundsicherung ließen sich nur einsparen, indem man möglichst viele Menschen nachhaltig in Arbeit bringe. "100.000 Arbeitslose weniger entsprechen etwa drei Milliarden Euro mehr für die öffentlichen Haushalte", so Weber. "Da ist der wirklich große Hebel."
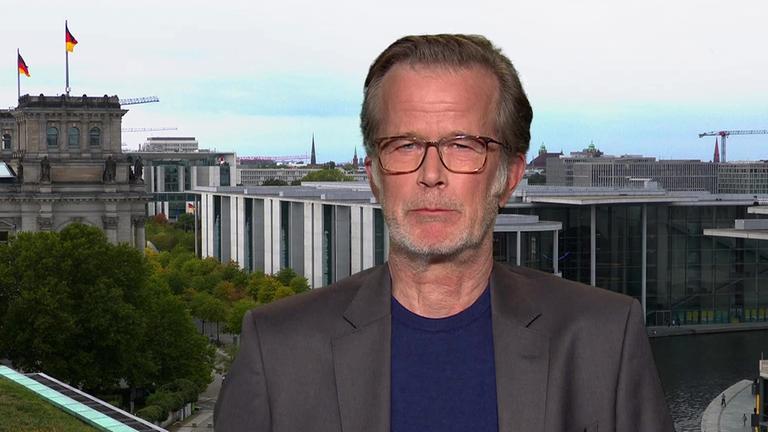
Christoph Mestmacher, ARD Berlin, über Kritik am ersten Haushalt von Schwarz-Rot und die Finanzplanung für 2026
tagesschau24, 18.09.2025 18:00 UhrSanktionen bei Pflichtverletzung
Beim Bürgergeld-Regelsatz will die schwarz-rote Koalition das Messer offenbar nicht ansetzen, zu groß ist die Sorge vor starken Widerständen und einem harten Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Auf das Existenzminimum hatte Karlsruhe in der Vergangenheit bereits geschaut und der Politik klare Vorgaben gemacht. Der Blick der Koalitionäre wird sich also eher auf härtere Sanktionen, den Vermittlungsvorrang und die Transferentzugsrate richten.
Bei den Sanktionen hatte bereits die Ampel-Regierung die Möglichkeit schaffen wollen, das Bürgergeld direkt für drei Monate um 30 Prozent zu kürzen. Da die Ampel zerbrach, wurde das Vorhaben aber nicht mehr umgesetzt, so dass aktuell weiter die vorherige Rechtslage gilt. Danach darf nach einer ersten Pflichtverletzung für einen Monat um 10 Prozent gekürzt werden, nach einer zweiten dann um 20 Prozent für zwei Monate und erst nach weiteren Pflichtverletzungen ist auch eine Kürzung um 30 Prozent machbar.
Vielen in der schwarz-roten Regierung ist diese Treppe ein Dorn im Auge, auch in der SPD, die gerne wieder stärker als Arbeiterpartei wahrgenommen werden möchte, nicht nur als Arbeitslosen-Partei. Härtere Sanktionen werden wohl Teil des ersten Änderungspakets sein.
Neben den Sanktionen ein zweites Thema: der Vermittlungsvorrang. Ein für die Union wichtiger Punkt: Bürgergeld-Empfänger sollen schnell wieder arbeiten. Langfristig dürfte es auch Änderungen bei der sogenannten Transferentzugsrate geben. "Wenn man selber Geld dazu verdient, dann verliert man erhebliche Teile des Bürgergeldes", sagt Ifo-Präsident Clemens Fuest. "Das heißt: Netto hat man kaum mehr, insofern lohnt es sich wenig, zu arbeiten.
Strukturelle Reformen in Rentenpolitik
In der Rentenpolitik hat der Kanzler viel versprochen: "Der Generationenvertrag muss neu gedacht werden", sagte er in der Generaldebatte zum Haushalt. Die Koalition will mehrere Maßnahmen noch in diesem Herbst im Paket verabschieden: Die Frühstart-Rente, die Aktiv-Rente, die Ausweitung der Mütterrente und die Haltelinie beim Rentenniveau, das bis 2031 nicht unter 48 Prozent fallen soll. Allein Mütterrente und Haltelinie schlagen in den kommenden Jahren zweistellige Milliarden-Löcher in den Haushalt.
Die junge Gruppe in der Union besteht deshalb auf ein Paket: "Die Niveaustabilisierung kann nur in Verbindung mit strukturellen Reformen kommen", sagt Pascal Reddig, Vorsitzender der Jungen Gruppe. "Immer wieder wurden dringend nötige Reformen auf die Zukunft verschoben - damit muss jetzt Schluss sein."
Die Diskussion über Reformen am Rentensystem hat die Koalition allerdings in eine Arbeitsgruppe verschoben. Die Rentenreformkommission soll 2026 ihre Arbeit aufnehmen. Dabei gelten Renten- und Gesundheitssystem als dringend reformbedürftig. Die Sozialabgaben könnten im ungünstigsten Falle schon bald bei mehr als 50 Prozent liegen, wie die Forscher vom IGES-Institut in einer Studie für die DAK warnen.
Gesundheitshaushalt 2025 - drittgrößter Anstieg
Der Bundeshaushalt für 2025 sieht auch deutlich mehr Geld für das Gesundheitsministerium vor. Die Ausgaben steigen auf 19,28 Milliarden Euro - das sind 2,57 Milliarden Euro mehr als im vergangenen Jahr. Damit hat der Gesundheitsetat den drittgrößten Zuwachs unter allen Ministerien.
Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) warb in den Beratungen für grundlegende Reformen, um das Vertrauen in die Sicherheit der Gesundheitsversorgung zu erhalten. Doch wie genau diese Reformen aussehen sollen, lässt sie offen und verweist auf die beiden Fachkommissionen für Gesundheit und Pflege die bereits einberufen worden sind. "Alles kommt auf den Prüfstand", so die Ministerin.
Wer soll die Kassen retten?
Neben der Krankenhaus- und Pflegereform dürfte die größte Baustelle im Gesundheitswesen derzeit das Milliardendefizit bei den gesetzlichen Krankenkassen sein. Seit Jahren wachsen die Ausgaben stärker als die Einnahmen - das Loch in der Kasse wird immer größer. Zwar verbuchen die Krankenkassen einen Überschuss von 2,8 Milliarden Euro, doch den brauchen sie dringend, um die gesetzlich vorgeschriebenen Rücklagen wieder aufzufüllen, die unter dem damaligen Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) aufgebraucht wurden.
Eine weitere Expertenkommission soll nun Vorschläge für eine grundlegende Reform der gesetzlichen Krankenversicherung vorlegen. Ziel sei es, "die Beiträge zu stabilisieren", sagt Warken. "Die zumutbaren Belastungen für die Versicherten, Arbeitgeber und die Gesamtwirtschaft hat ihre Grenzen erreicht", so die Gesundheitsministerin. Um die Entwicklung abzubremsen, braucht es mehr Geld. Doch dafür gibt es im Haus der schwarz-roten Koalition aktuell kaum Spielraum. Spannend bleibt also, ob es im Januar 2026 erneut zu Beitragserhöhungen kommen wird. Warken will das eigentlich verhindern.
Scharfe Kritik der Opposition am Gesundheitshaushalt
Der Haushaltsentwurf für das Bundesgesundheitsministerium stößt bei der Opposition auf deutliche Ablehnung. Politikerinnen und Politiker von Grünen, AfD und Linken werfen der Regierung vor, wichtige Probleme im Gesundheitssystem nicht anzugehen - und den Haushalt auf unsolide Weise zusammenzustellen. Dr. Paula Piechotta (Bündnis 90/Die Grünen) kritisiert besonders die geplanten vier Milliarden Euro Soforthilfen für Krankenhäuser. Diese würden nicht aus einem Gesundheitsfonds stammen, sondern aus Mitteln für Verkehrsprojekte, die umgewidmet wurden. Piechotta spricht von einem "Sündenfall" und dem "unsolidesten haushaltspolitischen Vorgehen der vergangenen Jahre".
Auch Martin Sichert von der AfD zeichnet ein düsteres Bild: Das Gesundheitssystem sei ungerecht, überreguliert und nicht bürgernah. Statt den Menschen zu helfen, diene es vor allem "Lobbyisten". Er fordert grundlegende Reformen, weniger Bürokratie und eine bessere Versorgung - insbesondere für gesetzlich Versicherte. Lange Wartezeiten auf Facharzttermine seien "im schlimmsten Fall lebensgefährlich", so Sichert.
Tamara Mazzi (Linke) warnt vor einem drohenden Zusammenbruch des Systems. Pflegekräfte seien überlastet, Angehörige allein gelassen und Kassenpatienten warteten monatelang auf Termine, während Besserverdienende bevorzugt würden. "Für viele Menschen funktioniert dieses System nicht mehr", sagt Mazzi. Anstatt gegenzusteuern, spare die Regierung ausgerechnet bei Aufklärung, Prävention und Forschung.
Milliarden sparen mit Digitalisierung
Also an den richtigen Stellen sparen. Doch wo genau? Darüber sind sich auch Experten nicht einig. Grundsätzlich gilt: Kurzfristige Einsparungen sind schwierig - viele Maßnahmen wirken mittel- bis langfristig. Dennoch gibt es ein großes Potenzial, vor allem durch bessere Steuerung, klügere Versorgungskonzepte und Digitalisierung.
Laut einer neuen Studie könnten die gesetzlichen Krankenkassen durch Digitalisierung, automatisierte Prüfverfahren und Künstliche Intelligenz bis zu 13 Milliarden Euro pro Jahr einsparen. Das entspricht rund vier Prozent der Gesamtausgaben, wie eine Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte zeigt. Besonders bei medizinischen Leistungen, Medikamenten und Krankenhausaufenthalten sehen die Autoren der Studie großes Potenzial. Allein durch automatisierte Prüfungen könnten hier bis zu zwölf Milliarden Euro eingespart werden.
Beispiel: Krankenhausrechnungen. Mithilfe von KI könnten fehlerhafte oder doppelte Abrechnungen schneller erkannt und verarbeitet werden - was heute Tage dauert, ließe sich künftig in Minuten erledigen und mit weniger Personal.
Kein großer Spielraum
Viel Spielraum Geld zu sparen, gibt es für die Ministerien nicht und jetzt droht zusätzlicher Ärger, der teuer werden könnte. Die Gesetzlichen Krankenkassen (GKV) haben vergangene Woche eine milliardenschwere Klage gegen den Bund eingereicht. Deren Kern: Der GKV-Spitzenverband der Kassen argumentiert, sie blieben weitgehend auf den Kosten für die Versorgung von Bürgergeldempfängern sitzen. Denn für deren gesundheitliche Versorgung erstatte der Bund den Kassen nicht die vollen Kosten.
Die Folge: Alle gesetzlich Versicherten zahlen höhere Beiträge, um die Kosten für die Krankenversicherung der Bürgergeldempfänger auszugeichen. Dieser Streit bringt die Bundesregierung zusätzlich unter Druck, in einer ohnehin schon herausfordernden Haushaltslage
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke



