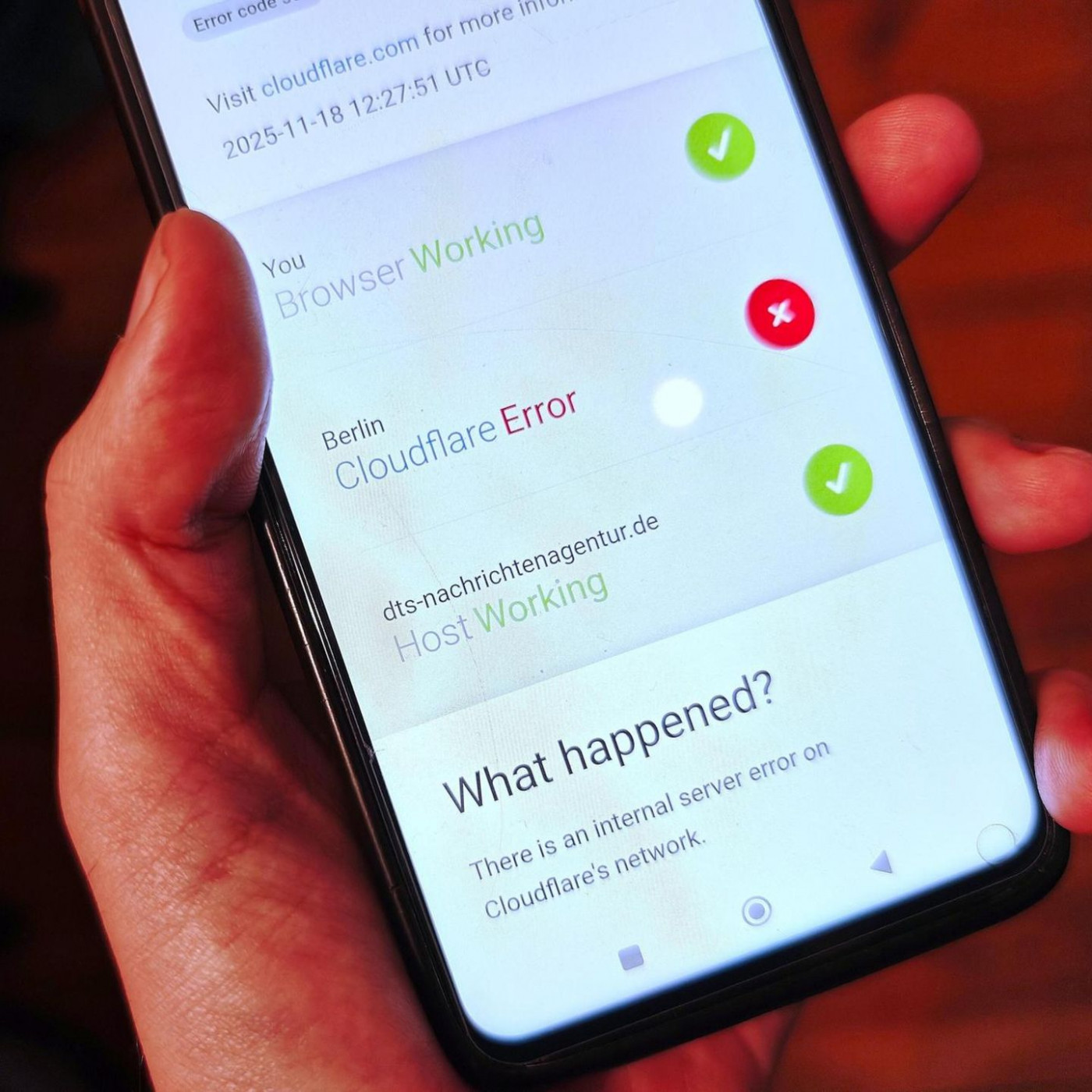Arbeit, Alltag, Schule, Kunst, Musik und die gesamte Industrie: Glaubt man der Techbranche, wird Künstliche Intelligenz nahezu jeden Bereich des menschlichen Lebens in irgendeiner Form verändern – und vieles völlig auf den Kopf stellen. Die größte Hürde sind ausgerechnet die fehlenden Ressourcen auf der Erde. Nun wollen die Tech-Mogule eine Lösung gefunden haben – und wenden dafür den Blick nach oben.
Der erste Schritt wurde in der vergangenen Woche gemacht. Als erstes Unternehmen hat das Start-up Starcloud in enger Zusammenarbeit mit dem Chip-Riesen Nvidia eine Art Testballon gestartet – und einen Satelliten ins All geschossen, der weitgehend aus Nvidias KI-Prozessor H100 und einem Energiesystem mit Solarzellen besteht. Man habe "Geschichte geschrieben", verkündete Starclouds Investor Y Combinator stolz. Glaubt man der Vision des Silicon Valley, sollen ähnliche Projekte die Zukunft der KI-Revolution sichern.
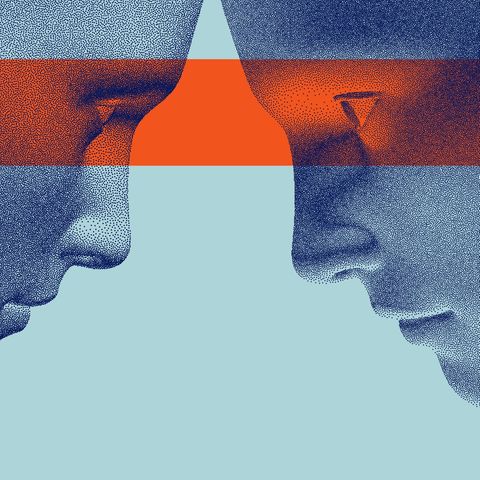
Künstliche Intelligenz "Unser Ziel ist, dass Ihr ChatGPT eine eigene Persönlichkeit entwickelt"
Die Grenzen des KI-Wachstums
Die steht nämlich vor einer gewaltigen Barriere. Obwohl die Techbranche Abermilliarden in auf KI-Berechnung spezialisierte Hardware investiert, kann sie diese nicht einmal annähernd in vollem Umfang nutzen. Der einfache Grund: Die KI-Rechenzentren benötigen gigantische Mengen an Strom und produzieren Abwärme, die mit Wasser gekühlt werden muss. "Wir haben viele Chips, die wir nicht mit Strom versorgen können", erklärte etwa Microsoft-Chef Satya Nadella vor zwei Wochen in einem Interview.
Das Problem wird sich nicht schnell lösen lassen – trotz der Ausgabebereitschaft des Silicon Valley. OpenAI, die Firma hinter dem Chatbot ChatGPT, versprach allein etwa Investments von unglaublichen 1,4 Billionen Dollar (etwa 1,2 Billionen Euro). Das entspricht mehr als dem Doppelten des Bundeshaushalts im vergangenen Jahr. Doch weil die Genehmigungsprozesse für Kraftwerke aufwendig und die Auflagen etwa in Bezug auf die Umwelt hochkomplex sind, dürfte es viele Jahre dauern, bis der Bedarf der KI-Konzerne tatsächlich gedeckt werden könnte.
Flucht ins All
Die Hoffnung der Branche ist deshalb der Weltraum. Würde es gelingen, die Rechenzentren in den Orbit zu verlegen, hätte das gleich mehrere große Vorteile. Der wichtigste ist die Energie selbst. Während auf der Erde jeder Fleck mindestens ein Drittel des Jahres keine Sonneneinstrahlung abbekommt, kann ein Satellit im sogenannten sonnensynchronen Orbit das ganze Jahr Solarenergie erzeugen. Hinzu kommt, dass durch die fehlende Atmosphäre die Sonnenstrahlung effizienter eingefangen werden kann.
Die möglichen Einsparungen sind beachtlich. Bis zu achtmal so viel Energie ließe sich aus denselben Solarpanels herausholen, errechnet eine Studie von Google. Weil die Panels durchgehend bestrahlt werden, muss man keine Energie zwischenspeichern – und spart Batterien. Weil die Abwärme direkt als Strahlung ins All abgegeben würde, könnte man im Gegensatz zum Betrieb auf der Erde auf das Wasser für die Kühlung der Rechenzentren verzichten. Dafür müssten aber erst technische Voraussetzungen geschaffen werden.

Interview Wir behandeln ChatGPT wie einen Menschen. Was steckt dahinter?
Hoffnung in "Moonshots"
Ob das in der Praxis möglich ist, bleibt aktuell aber noch offen. Googles Satelliten-Projekt Suncatcher sei ein "Moonshot" – ein Schuss ins Blaue –, erklärte Sundar Pichai, Chef von Googles Mutterkonzern Alphabet, nach der Ankündigung in der vergangenen Woche. Der Konzern plant, 2027 zwei erste Testsatelliten in den Orbit zu befördern.
Rentabel wird das Modell nach Schätzungen des Suncatcher-Teams frühestens in zehn Jahren. Dann sollen die Kosten für den Transport ins Weltall auf 200 Dollar pro Kilogramm sinken, prognostiziert die Studie. Erst dann seien die Inbetriebnahme und die Folgekosten eines solchen Weltraum-Rechenzentrums mit dem Bau eines klassischen Äquivalents auf der Erde vergleichbar.

Blue Origin vs. SpaceX Die Milliardäre und ihr unfairer Wettlauf zum Mond: Bezos verklagt wegen Musk die Nasa
Der Amazon-Gründer schwärmt
Auch Amazon-Gründer Jeff Bezos erwartet zehn bis zwanzig weitere Jahre Entwicklungszeit für die Weltraum-Rechenzentren. Bei einer Konferenz in Turin hatte er Ende Oktober von den Möglichkeiten jenseits der Erde geschwärmt. "Es gibt keine Wolken, keinen Regen, kein Wetter", erklärt er die Vorteile. "Wir haben es schon mit Wettersatelliten geschafft." Mit dem Unternehmen Blue Origin hat sich Bezos bereits seit Längerem der Eroberung des Weltalls verschrieben. Nach Rechenzentren kann er sich als nächsten Schritt auch die Verlagerung von Fertigungsstätten ins All vorstellen, erklärte er in Turin.
Elon Musk, der andere Techmilliardär mit einer eigenen Weltraumfirma, mischte sich gewohnt vollmundig in die Debatte ein. "Wir müssen einfach die Starlink-V3-Satelliten hochskalieren", erklärte er in einer Antwort auf einen Artikel über die technischen Herausforderungen der Weltraum-Datenzentren. "Das werden wir bei SpaceX tun."
Ganz so einfach dürfte es aber wohl nicht werden. Vor allem die Pläne zur Ableitung der Hitze werden von Weltraum-Experten angezweifelt. Schon jetzt sammelt sich immer mehr gefährlicher Schrott im Orbit (hier erfahren Sie mehr). Zudem würden die Weltraum-Rechenzentren auch eine größere Verwundbarkeit bedeuten. Gerade erst hatte Verteidigungsminister Boris Pistorius gewarnt, dass Russland und China zunehmend auch im All auf Aufrüstung setzen.
Quellen: Google, Reuters, Ars Technica, Elon Musk, Chaotropy
- Amazon
- Silicon Valley
- Künstliche Intelligenz
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke