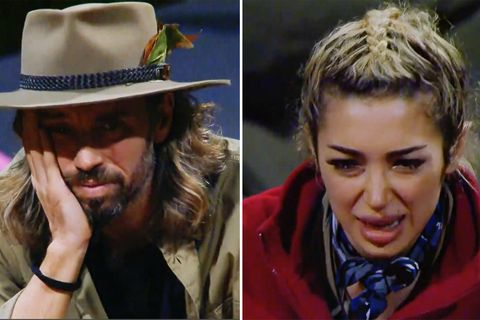Er wirkt unspektakulär, freundlich zugewandt, dem Gegenüber lauschend. Er könnte auch ein netter Computergeek sein, ein sympathischer Streber. So bleibt Damiano Michieletto stets in Deckung, wird übersehen. Dabei ist er einer der meistbeschäftigten Opernregisseure in Europa.
Damiano Michieletto hatte im Oktober Premiere mit einem neuen „Falstaff“ an der Dresdner Semperoper und eröffnete im November die Opernsaison in Rom mit einem neuen „Lohengrin“. Gleichzeitig wurde seine genuesische Inszenierung von Nino Rotas Spätbuffa „Der Florentinerhut“ mit Erfolg in Lüttich gespielt. Für diese Saison stehen drei Premieren an: Verdis „Simon Boccanegra“ in Venedig, Mozarts „La clemenza di Tito“ in Zürich und auf der Bregenzer Seebühne im Juli 2026 Verdis dort noch nie gezeigte „La traviata“.
Zudem zeichnet der gerade 50 Jahre alt gewordene Venezianer Michieletto seit 2025 für den Festivalsommer der Römischen Oper in den Caracalla-Thermen verantwortlich. Im letzten Sommer brachte er selbst eine sehr spezielle Version der „West Side Story“ heraus, die neonbunt-lockend und zugleich ernsthaft war. Vorher feierte er mit der spektakulären Uraufführung von Francesco Filideis „Il nome della rosa“ nach dem Eco-Besteller einen Erfolg an der Mailänder Scala. „Wir hatten großes Glück, denn es hätte auch eine Katastrophe werden können“, so Michieletto über neue Opern. „Sie sind riskant und kostspielig, aber für das Überleben dieser Kunstform absolut unerlässlich. Ohne neue Werke wird dieses System nicht ewig bestehen.“
An Weihnachten kam in Italien Damiano Michielettos erster Kinofilm „Primavera“ in die Kinos: eine in Venedig gedrehte Geschichte über Antonio Vivaldi und die Selbstfindung einer Geigerin nach dem Roman von Tiziano Scarpa. Die Kritiken waren des Lobes voll für einen „klassischen, dabei zeitgenössischen Film, der poetisch von der ungerechten Stellung der Frau im 18. Jahrhundert erzählt“.
Und jetzt wird Damiano Michieletto am 6. Februar die Eröffnung der Olympischen Winterspiele Mailand–Cortina d’Ampezzo gestalten. „Ich weiß auch nicht, warum es so viel ist, ich kann offenbar schlecht Nein sagen“, grinst ein erschöpfter, bleicher, aber wacher Michieletto in einem nüchternen Besprechungsraum der Römischen Oper bei seinem doppelten Espresso im Plastikbecher.
„Im Grunde geht das seit meinem sogenannten Durchbruch mit ‚Der diebischen Elster‘ beim Rossini Festival in Pesaro so“, sinniert er. „Aber eins ist sicher: So spektakulär und plötzlich kontrovers wie bei meinem Opernkollegen Thomas Jolly 2024 in Paris wird es im Mailänder San Siro Olympic Stadium nicht werden. Ich habe ein ganz anderes Budget und natürlich keine so einzigartige Location. Ich habe zum Thema ‚Harmonie‘ aber immerhin Mariah Carey, Andrea Bocelli, Cecilia Bartoli, die die griechische Originalhymne singt, und Lang Lang dabei. Und ich gebe mir Mühe, für ein paar Wow-Effekte zu sorgen.“
So wie damals 2007 in einer Rossini-Inszenierung in Pesaro, mit einem spektakulären Ambiente aus schwebenden Riesenröhren seines ständigen Bühnenbildners Paolo Fantin – postwendend mit dem Premio Franco Abbiati, Italiens wichtigstem Regiepreis, ausgezeichnet. Ab da ging es für den damals 32-Jährigen, der in Mailand Regie studiert hatte, so richtig los. Selbst im regietheaterverwöhnten Deutschland, wo er in Berlin, München und anderswo gearbeitet hat und wo man Inszenatoren aus Italien sonst als kulinarikverliebten Dekorateuren misstraut.
Woran das liegen mag? „Ich habe meist eine Idee für ein Stück, die mich gehörig voranbringt“, geht Damiano Michieletto beim letzten Espressoschluck in sich. Jetzt sieht er womöglich seinem Großvater ähnlich. Der war Schreiner, sog aber beim Arbeiten Opernmusik in sich auf, sang mit und nutzte sie für sein Handwerk. „Eine Idee reicht zwar noch nicht“, so Michieletto, „ist aber doch manchmal der Moment, an den man sich später erinnert.“ Das sind oft Bilder oder Orte: etwa ein Hotel, so wie in einer bis heute am venezianischen Fenice-Theater gezeigten Mozart/da-Ponte-Trilogie. Oder eine Containerlandschaft als Schauplatz in Puccinis Einakter-Trias „Il trittico“. Oder eine Kunstgalerie für Rossinis „Reise nach Reims“.
Seine Inszenierungen reisen von Amsterdam bis Australien, von Berlin bis Brüssel, von Paris bis Polen und von Wien bis New York. Damiano Michieletto trifft meist einen guten Mittelweg, der ihn für eine „Salome“ in Mailand oder eine „Carmen“ in London ebenso qualifiziert wie für eine rare „Verlobung im Kloster“ Sergei Prokofjews im Theater an der Wien. Auch wenn es mal, wie in London nach einer Premiere von Rossinis „Wilhelm Tell“, beim konservativen Royal-Opera-Publikum Randale gab – wegen einer allzu grafischen Gruppenvergewaltigung. „Ich glaube, das war, weil ich die Balletteinlage mit Grausamkeit konterkariert habe“, vermutet Michieletto. „Was aber nur die emotionale Kraft der Musik zeigt.“
Er kann kleinformatig und in großen Dimensionen denken, seine Personenregie ist zupackend, er hat Ideen, aber er verstört selten. Er ist der Richtige für eine Uraufführung in Amsterdam wie für eine Barockoper in Leipzig. Sein Stil ist persönlich, aber international kompatibel, nie trashig, sondern bei aller oft bunter Schrägheit immer ästhetisch. Michieletto ist ein verlässlicher, stetig liefernder, ausgeglichener Künstler. Selbst im größten Terminstress.
Vor allem: Damiano Michieletto ist leise, für einen Italiener spricht er in sehr nüchternem Tonfall. Das Flamboyante bringt er nur auf die Szene, er selbst ist pünktlich, organisiert, achtsam. Man erreicht ihn einfach, denn er ist unbedingt ein Teamplayer, das beweisen schon seine seit Jahrzehnten mit ihm agierenden Mitkolaborateure. Und er kann teilen. Seinen römischen Job nutzt er, um im Sommer für das Musiktheater neue Spielplätze zu entdecken, etwa die erstaunlich ruhige, intime Apsis der Maxentiusbasilika in den Forumsruinen – perfekt im Heiligen Jahr für das in Rom vom jungen Händel komponierte Oratorium „La Resurrezione“ wie auch für den hier sehr konzentrierten „Don Giovanni“.
Für beide Stücke hatte Michieletto spannende, jüngere Kollegen eingeladen: die kraftvoll konzeptstark arbeitende, bereits für Bayreuth gehandelte Italienerin Ilaria Lanzino sowie den Russen Vasiliy Barkatov, der später im Jahr die Scala-Inaugurazione inszenierte. „Die Themen Spiritualität und Versöhnung liegen mir sehr am Herzen, weshalb ich für Rom einen Weg geschaffen habe, den wir ‚Zwischen dem Heiligen und dem Menschlichen‘ genannt haben.“
Und er selbst nahm sich am traditionsreichen Sommeropernhauptspielort, vor den majestätisch geborstenen Caracalla-Thermenmauern, Leonard Bernsteins „West Side Story“ vor. Auf Englisch, was vor allem für die auch singenden Tänzer ein vokaler Stolperparcours war – mit einem Handlungstwist in einem verlassenen Spaßbad zwischen türkisfarbenem Becken, Sprungturm, rostigen Teilen der Freiheitsstatue sowie pink blinkenden Riesenlettern. „Ein Ort, der Sehnsüchte nach Spiel, Glück, Unbeschwertheit und Liebe verbirgt“, sagt Michieletto. „Der gewaltsame Zusammenstoß zwischen den beiden Banden in diesen verlassenen Ruinen steht für den Wunsch nach Rache, die Suche nach Identität und Freiheit.“
Das rief die mit Argusaugen über ihre Rechte wachende Bernstein Foundation auf den Plan, mit der wochenlang über die ungewöhnliche Szene diskutiert wurde. Am Ende hatte Michieletto aber einen für ihn tragbaren Kompromiss erreicht.
Dieser Regisseur liebt die Abwechslung: zwischen ernst und heiter, groß und klein, bekannt und selten, Oper, Musical und auch Theater. Dabei will er immer Geschichten erzählen, bisweilen in Rätseln, aber lösbar und unterhaltsam. Die Bühne soll in ferne Welten entführen, verzaubern, sie darf auch verstören. Da ist er ganz Italiener, für den das Theater eine unerschöpfliche Wunderkiste aus Kulissen und Verkleidungen ist. Nur die ganz großen Klopper etwa von Richard Wagner hat er sich mehrheitlich noch aufgehoben. Dafür sollen die Caracalla-Thermen künftig mit Wasserbecken wieder ganz wie in der Antike aufgehübscht werden.
„Ich entdecke immer noch neue Sprachen, in denen ich mich ausdrücken möchte“, sagt Damiano Michieletto auch über sein jüngstes Filmabenteuer. „Als Venezianer saugt man dort Vivaldi-Klänge quasi mit der Muttermilch auf. Manchmal fast zu viel und nicht immer in erster Qualität. Trotzdem war gerade ‚Primavera‘ ein schönes Heimkommen. Denn auch wenn ich inzwischen in der ganzen Welt unterwegs bin: Venedig hat mich nie losgelassen.“
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke