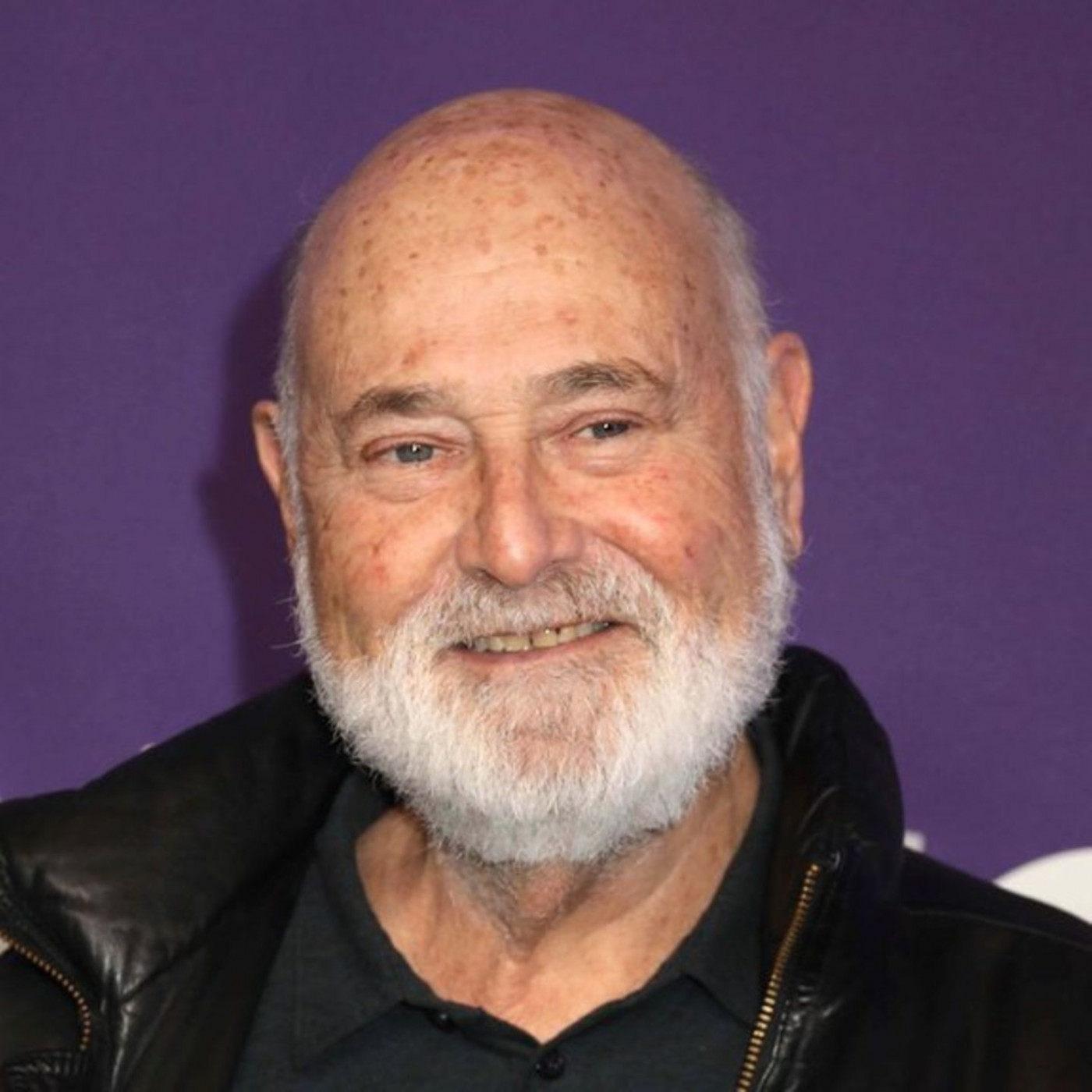Mal ein Fachbuch. Aber ein Fachbuch, das es in sich hat. In mehrfacher Hinsicht. Einesteils führt es ein Unternehmen zu Ende, das inzwischen historisch geworden ist: die von den verstorbenen Helmut de Boor und Richard Newald begründete „Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart“. Generationen von Germanisten haben mit den Bänden dieser Edition gelebt und gelernt. Andernteils führt Helmuth Kiesel, emeritierter Professor für Neuere Deutsche Literatur an der Universität Heidelberg, hier in stupender Umfänglichkeit zusammen, was zusammen gehört: deutschsprachige Literatur, die zwischen 1933 und 1945 innerhalb und außerhalb Deutschlands geschrieben wurde.
Das ist beileibe keine Selbstverständlichkeit. In der jungen Bundesrepublik hatte Literatur, die im Exil entstanden war, oft einen schweren Stand. Seit den 1960er-Jahren fiel man ins andere Extrem: Nun galt die andere Seite kaum noch etwas. Man konnte sich bei dieser Umwertung auf Thomas Mann berufen. Von ihm stammt die Maximalposition der Verachtung dessen, was im sogenannten Dritten Reich erschienen war: „Es mag Aberglaube sein, aber in meinen Augen sind Bücher, die von 1933 bis 1945 in Deutschland überhaupt gedruckt werden konnten, weniger als wertlos und nicht gut in die Hand zu nehmen. Ein Geruch von Blut und Schande haftet ihnen an. Sie sollten alle eingestampft werden.“
Es fiel den Unterstützern dieser These lange Zeit nicht auf, dass Thomas Mann mit seinem Bannfluch auch die ersten Bände seiner „Josephs“-Tetralogie hätte einstampfen lassen müssen, denn sie erschienen sehr wohl nach 1933 noch in Deutschland. Es war ein langwieriges und mühseliges Verfahren, Arbeiten von Autoren, die nicht aus dem „Tausendjährigen Reich“ emigriert waren, Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.
1981 erschien das Buch, das die Wende einläutete. Bezeichnenderweise schrieb es kein Fachgermanist, sondern ein Journalist. Er hat seine Karriere bei der „Welt“ begonnen und heißt Hans Dieter Schäfer. Seiner materialreichen Studie gab er den Titel „Das gespaltene Bewusstsein. Deutsche Kultur und Lebenswirklichkeit 1933 und 1945“. Die Kernthese: Es war nicht alles nationalsozialistisch oder auch nur nazikonform, was sich kulturell unter Hitler regte. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Damals eine Sensation.
Schäfers Untersuchungen sind bis zum heutigen Tag erkenntnisleitend, und auch Kiesel folgt ihren Spuren. Natürlich arbeitet er aber die zahllosen Spezialuntersuchungen in seine Darstellung ein, die seitdem zur nationalsozialistischen Literaturpolitik und zum damaligen literarischen Markt, zum Leseverhalten der Deutschen unter der Diktatur, aber vor allem zu den Wegen und Wandlungen deutschsprachiger Schriftsteller zwischen 1933 und 1945 entstanden sind. Herausgekommen ist dabei jetzt ein frei von akademischer Begriffsbijouterie formuliertes, differenziertes und übrigens auch menschlich sympathisches Frontenverwirrbuch. Es macht sich den Appell eines anderen großen Exilanten zu eigen.
Brechts Appell „An die Nachgeborenen“
In seinem Gedicht „An die Nachgeborenen“ mahnte Bertolt Brecht schon 1934: „Ihr, die ihr auftauchen werdet aus der Flut / In der wir untergegangen sind / Gedenkt / Wenn ihr von unseren Schwächen sprecht / Auch der finsteren Zeit / Der wir entronnen sind.“ Und das Gedicht, das zweifellos zu den wichtigen lyrischen Hervorbringungen des vergangenen Jahrhunderts gehört, mündet in die Bitte: „Gedenkt unserer / Mit Nachsicht“.
Nichts anderes tut Kiesel. Und er übt Nachsicht mit allen. Er scheut sich zwar nicht, moralisches und/oder politisches Fehlverhalten beim Namen zu nennen, das es damals auf beiden Seiten gab – bei den Bejublern des „Führers“ sowieso, aber auch Brecht selbst gibt mit seiner Verteidigung der stalinistischen Säuberungen und anderer Verbrechen der sowjetischen Hemisphäre ein frappantes Beispiel für dieses Fehlverhalten. Doch nicht das moralisch-politische Wohlverhalten ist Kriterium von Kiesels Darstellung, sondern „Erfassungsbreite“, wie der Autor das nennt.
Möglichst breit will er „repräsentative, zeitgeschichtlich interessante“ Strömungen, Genres, Texte, die zwischen 1933 und 1945 entstanden sind oder weiterliefen, erfassen und würdigen. Literaturwirklichkeit also, doch anders als bei Schäfers Lebenswirklichkeit, unter Ausschluss der „Unterhaltung“. Das ist arbeitsökonomisch verständlich (schon so umfasst das Buch 1300 Seiten Text), aber auch bedauerlich. Denn in Unterhaltungsliteratur spricht sich gleichfalls viel Repräsentatives, zeitgeschichtlich Interessantes aus – mal ganz abgesehen davon, dass man mit dieser Abgrenzung einem Fantasma huldigt. Schließlich sind auch „Gipfelwerke“ oft unterhaltsam. Wer sich bei der Lektüre von Thomas Manns „Zauberberg“ nicht gut unterhält, der ist nicht zu unterhalten.
Doch zurück zur Zusammengehörigkeit von deutscher Literatur intra und extra muros, die laut Kiesel von ca. 2500 Exilanten und ca. 20.000 reichsdeutschen Autoren getragen wurde. Die Zusammengehörigkeit erweist sich schon darin, dass beide Gruppierungen „unter dem Zeichen des Hakenkreuzes“ standen. Auch wenn, wie Kiesel unterstreicht, die „Wahrung literarischer Qualität“ und die „Weiterentwicklung narrativer, lyrischer, dramatischer Ausdrucksformen“ fast allen damals Schreibenden ein Anliegen war, so wurde doch das Ästhetische dem Primat des Politischen notgedrungen untergeordnet.
Eine Zeit im Ausnahmezustand
Die Jahre 1933 bis 1945 bezeichnen schließlich einen permanenten Ausnahmezustand. Für die einen, weil sie nicht mehr frei oder unter Umständen gar nicht schreiben konnten oder sich zu literarisch agitatorischen Steigbügelhaltern der Nazis machten. Für die anderen, weil sie sich verpflichtet fühlten, zu informieren, aufzuklären, in vielen Fällen auch zu kämpfen. Aber immer war der Gegenstand der Reflexion Hitlerdeutschland, der Faschismus, in den ambitioniertesten Arbeiten sogar der Verfall der europäischen Zivilisation generell. Hier nimmt sich Kiesel beispielsweise die „Amazonas“-Trilogie des von Alfred Döblin vor, aber auch Romane wie Hermann Brochs „Tod des Vergil“, Thomas Manns „Doktor Faustus“, Frank Thieß’ „Das Reich der Dämonen“. Sowie nicht zuletzt, aus dem Bereich der Dramatik, Gerhart Hauptmanns späte „Atriden“-Tetralogie, aber auch die christliche Lyrik eines Werner Bergengruen oder Reinhold Schneider – die vier Letztgenannten sind Autoren, die in Deutschland geblieben waren.
In der Zusammenstellung der genannten Werke wird ein weiteres Epochenmerkmal deutlich: der Rückgriff in die Geschichte. Bereits ein beliebtes Genre in der Weimarer Republik, schwillt die Welle des historischen Romans nach 1933 kraftvoll an. Neben Verfallsepochen gibt es vor allem in der Exilliteratur die Darstellung des guten Herrschers (Heinrich Manns „Henri IV“; Thomas Manns „Joseph der Ernährer“) oder des humanistischen Vorzeigeintellektuellen (Stefan Zweigs „Triumph und Tragik des Erasmus von Rotterdam“).
Im Reich hingegen dient die historische Einkleidung eher der Kritik an den verbrecherischen Auswüchsen der NS-Herrschaft. So geschehen in Reinhold Schneiders Kampfansage an den Rassismus jeglicher Couleur in „Las Casas vor Karl V.“ oder auch in Ernst Jüngers wiewohl historisch nicht genau situierten „Auf den Marmorklippen“, wo anhand der Beschreibung fiktiver „Schinderhütten“ 1939 die Folterkammern der Gestapo in die Literatur Einzug halten.
Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch der von Kiesel nicht herangezogene „Robespierre“ Friedrich Sieburgs. Diese Romanbiografie führte 1935 erstmals vor, was man später messianisches Politikverständnis genannt hat. Der französische Revolutionsterrorist weist dabei in Sieburgs Zeichnung jedenfalls deutlichere Parallelen zu Adolf Hitler auf als die Herrscherfigur des oft (und auch von Kiesel) als Beispiel indirekter Kritik genannten Romans „Der Großtyrann und das Gericht“ von Werner Bergengruen. Hier geht es um einen kultivierten Renaissancefürsten, der einen (!) Mord begeht. Das hat nun wahrlich nichts mit dem „Dritten Reich“ zu tun. Wohl aber gibt es in der dissidentischen Literatur Hitlerdeutschlands das Bild des fürsorglichen und auf Frieden bedachten Herrschers, wozu sich Jochen Klepper aparterweise den „Soldatenkönig“, also Friedrich Wilhelm I. von Preußen, aussuchte („Der Vater“).
Die vergessenen Ambivalenzen
Alle genannten Bücher spielten so geschickt mit Ambivalenzen, dass sie die NS-Zensur passieren, gute Kritiken in der NS-Presse hervorrufen und sogar im Fall von Jochen Klepper große Verkaufserfolge erzielen konnten. Hier muss man allerdings hinzufügen: Auf die Dauer genutzt hat es nicht. Jochen Klepper ist heute genauso vergessen wie Werner Bergengruen oder Reinhold Schneider. Das gilt auch für den auflagenstärksten Dichter jener Jahre, Ernst Wiechert. Dieser erklärte Anti-Nazi, der 1938 für seine aufrührerischen Reden ins KZ Buchenwald eingewiesen wurde, erreichte mit seinen Büchern eine Auflage von weit über eine Million Exemplaren.
Sein faszinierendstes Werk verfasste er unmittelbar nach der Entlassung aus der Haft. „Das einfache Leben“, 1939 erschienen, erzählt vom Rückzug eines von der Gegenwart angeekelten Männerhelden in die masurischen Wälder. Auch dieser Roman ist schon lange nicht mehr das Buch, das es für zwei, drei Generationen war. Was schade ist. Einen Kult muss man zwar nicht um das Buch treiben, aber lesen sollte es nicht nur, wer ostpreußische Wurzeln hat: Hier wird seelische Kraftnahrung für Nonkonformisten verabreicht. Beides brauchen wir immer – Nonkonformisten wie seelische Kraftnahrung!
Man muss es klar sagen: Das Rennen gemacht haben die Exilautoren. Vor allem Brechts Dramen sowie Zeitromane, die vom deutschen „Abmarsch in die Barbarei“ handeln, aber auch vom Alltag und den Nöten im Exil, werden nach wie vor gespielt und gelesen – mit Recht. Um nur drei weitere Beispiele nennen, Klaus Manns „Mephisto“ ist bei aller Knalligkeit eine köstliche Satire auf das Umfallertum aus Karrieregründen im „Dritten Reich“. Arnold Zweigs „Das Beil von Wandsbek“ eine anrührende und erstaunlich gut informierte, anschauliche Geschichte über einen Mitläufer. Und dies, obwohl der Autor sie denkbar weit weg vom Hamburg der Dreißigerjahre, nämlich in Palästina, schrieb. Anna Seghers wiederum nahm in „Das siebte Kreuz“ auf eine bis heute erschütternde Weise das Leben der politisch Verfolgten in den Blick.
Was hat die andere Seite vorzuweisen? Erstaunlicherweise die literarisch innovativeren Texte! Gottfried Benns „Statische Gedichte“ markieren den unübertroffenen Höhepunkt eines melancholischen Neoklassizismus, den es in der deutschen Lyrik des 20. Jahrhunderts gibt. Friedo Lampes Prosa „Am Rande der Nacht“ und „Septembergewitter“ führen die aus Amerika stammende Erzählform der simultanen short cuts in die deutsche Literatur ein. Ilse Molzahns „Nymphen und Hirten tanzen nicht mehr“ führt, am Beispiel Breslaus übrigens, die libertäre „Asphaltliteratur“ zu neuen Höhen. Und Ernst Wiechert hat über seine KZ-Erfahrung mit dem Bericht „Der Totenwald“ das wohl eindrucksvollste Dokument der Empathie in das Leiden der Verfolgten vorgelegt, das die deutsche Literatur jener Zeit kennt. Er konnte allerdings erst nach Kriegsende erscheinen.
Sie alle und viele mehr werden von Kiesel gewürdigt, werden wiederentdeckt oder überhaupt erst bekannt gemacht. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei erfreulicherweise der Lyrik. Hier wird beispielsweise an die gewaltigen Klagegesänge jüdischer Autoren erinnert wie an die Bilanz deutsch-jüdischen Zusammenlebens über viele Jahrhunderte hinweg von Karl Wolfskehl, der sich nach Neuseeland retten konnte („An die Deutschen“). Aber auch an das ergreifende „Dachau-Lied“ Jura Soyfers, der im dortigen KZ umkam.
Wer hingegen auf der anderen Seite für die christliche Botschaft empfänglich war, konnte sich in seinem Schmerz und in seiner Scham an Gedichte unter anderen von Reinhold Schneider halten, die gerade aus eingestandener Hilflosigkeit ihre Eindringlichkeit beziehen: „Allein den Betern kann es noch gelingen“, beginnt eines seiner damals berühmten Sonette. Auch Thomas Manns 1943 vollendeter Roman über den langen Weg in die deutsche Katastrophe, sein unübertroffenes Hauptwerk „Doktor Faustus“, endet mit den Zeilen: „Ein einsamer Mann faltet seine Hände und spricht: Gott sei eurer armen Seele gnädig, mein Freund, mein Vaterland.“ Denn es gibt ein Ausmaß des Schreckens, angesichts dessen der rationale Diskurs verstummt. Eingedenk dieses demütigen Wissens ist dieses beeindruckende Buch geschrieben. Es darf schon jetzt als Standardwerk bezeichnet werden. Ein Standardwerk, vor dem man sich nur verneigen kann.
Helmuth Kiesel: Schreiben in finsteren Zeiten. Geschichte der deutschsprachigen Literatur 1933-1945. C.H. Beck, 1392 Seiten, 68 Euro.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke