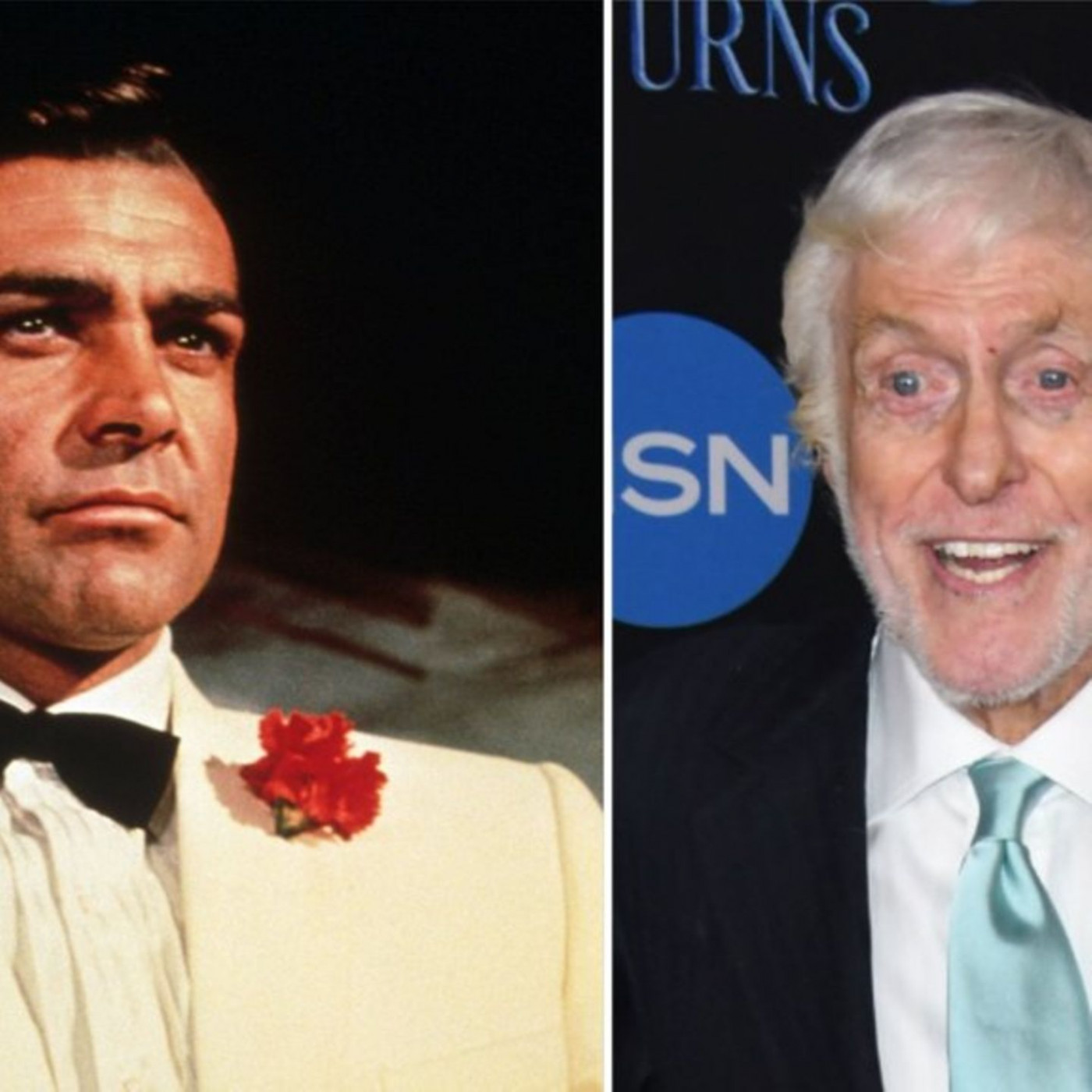Der Grund dafür, dass meine ersten ‚Soft Sculptures‘ wie Penisse geformt waren, war meine Angst vor Sex als etwas Schmutzigem. Die Leute denken oft, dass ich von Sex besessen sein muss, da ich so viele solcher Objekte herstellte, aber das ist ein totales Missverständnis. Das Gegenteil ist der Fall – ich mache Dinge, weil sie mir Angst einjagen.“
Als Yayoi Kusama diese Sätze in ihrer 2002 erschienenen Autobiografie schreibt, lebt sie bereits seit 1977 freiwillig in einer Nervenheilanstalt in Tokio. Ihr Atelier liegt fußläufig gegenüber, 2017 eröffnete sie unweit von dort ihr eigenes Museum. Jahrzehntelang aber war Kusama eine Unbekannte, in Japan gar als Künstlerin verfemt. Heute gibt es kaum jemanden, der ihre schwarz-gelb gepunkteten Riesenkürbisse, Spiegelräume und Environments nicht kennt: Die Powergalerie David Zwirner hat seit 2013 alles darangesetzt, die inzwischen 96-jährige Künstlerin mit dem knallroten Pagenkopf und strengen Blick in einen Superstar zu verwandeln.
Großsammler feiern sie ebenso wie Besuchermassen, die in ihren Ausstellungen Selfies machen wollen. Derzeit strömen sie in die Fondation Beyeler bei Basel, wo eine Retrospektive stattfindet, die anschließend ins Museum Ludwig nach Köln und ins Stedelijk Museum in Amsterdam wandert. Alt und Jung springen aufgeregt umher, haben sich bunt angezogen und ihre Schuhe und Handtaschen mit Punkten beklebt. Sie tasten sich mit Smartphones voran, auf der Suche nach den lustigen „Polka Dots“.
Doch so leicht macht die Ausstellung es ihnen nicht. Dass hinter dem poppigen, groß aufgezogenen Spätwerk ein sensibles, leidgeplagtes Wesen steckt, das seit seiner Kindheit an Ängsten und Halluzinationen leidet, lässt erstmal alle ins Leere laufen, die auf die „Prinzessin der Punkte“ eingestellt waren. So wird Kusama von Medien und Museumsleuten gern genannt, womit man sie und ihr Werk allerdings infantilisiert.
Kusama wurde 1929 im japanischen Matsumoto geboren. Eines ihrer ersten Werke ist ein delikates Selbstporträt, das sie im Alter von zehn Jahren mit Bleistift zeichnet, auf dem sie in einem Meer aus Punkten die Augen geschlossen hält. Schon damals kämpfte sie mit Visionen und imaginierte sich, in Blumenfeldern liegend, in eine netzartig mit allem verbundene Welt hinein. Ihre Eltern betrieben ein Saatgutgeschäft, bauten Blumen und Gemüse an – Kusama verbrachte viel Zeit zwischen Pflanzen, was ihr lebenslang als Inspirationsquelle diente.
In der Ausstellung erkennt man das eingangs an dem floralen, aber niemals illustrativen oder gar fröhlichen Frühwerk: Kusamas organische, meist mittig wie Krater in die kleinformatigen Bildträger hineingesetzten Formen aus den 1950er-Jahren sind Hybride aus Gewächsen und Gesichtern. Man könnte sagen, sie seien Paul-Klee-artig versponnen oder Edvard-Munch-ähnlich geplagt, auch die halluzinativen Gespinste von Unica Zürn mag man darin erkennen. Doch Kusamas Bildwelten kommen auch ohne Referenzen aus.
Schon während ihres Kunststudiums in Kyoto entwickelte sie eine autonome Bildsprache, mit der sie die traditionelle Kunst ihres Landes vom Tisch fegte, denn die reichte einfach nicht aus, um auszudrücken, was sie quält. Bildtitel wie „Screaming Girl“ oder „Corpses“ verweisen auf eine Todesnähe, die man in geisterhaften Gesichtern und dunklen, alles verschlingenden Wirbeln unschwer erkennt. Kusama erlebte den Abwurf der Atombomben über ihrem Heimatland 1945, was eine immense Existenzangst in ihr ausgelöst haben muss. Doch auch die Untreue ihres Vaters, dessen Ehebruch die Mutter sie auszuspähen zwang, versetzte sie in einen Zustand der Angst und Depression, den sie fortan mit Kunst zu bekämpfen versucht hat.
Ermutigt durch einen von ihr angeregten Briefwechsel mit Georgia O’Keeffe, der damals erfolgreichsten Künstlerin in den USA, zog Kusama 1958 nach New York und tauchte ein in die Downtown-Künstlerszene um Eva Hesse, Donald Judd, Andy Warhol und Claes Oldenburg. Hier entwickelte sie ihre „Infinity Net“-Serie, deren filigraner Atmosphäre zwischen Minimal-Art und automatistischer Zeichnung man sich nicht entziehen kann: Große, weißliche oder rote Leinwände mit unzähligen zarten Punkten lassen einen körperlich eintauchen in die alles umspannenende Traumwelt Kusamas.
1962 begann sie, ihre Allover-Ideen ganz in den Raum auszudehnen: In der Ausstellung sind Schaufensterpuppen, Sessel, Schuhe und Kleider mit silbrig besprühten Würsten benäht, die man, auch wenn das hier nicht so genannt wird, unschwer als Phalli erkennen kann. „Ich begann, Penisse herzustellen, um meine Ekelgefühle vor Sex zu heilen. Diese Objekte wieder und wieder zu reproduzieren war mein Weg, die Angst zu erobern. Es war eine Art Selbsttherapie, die ich ‚Psychosomatische Kunst‘ nannte.“ Doch Kusamas Trauma wird hier nicht ausgebreitet, ebenso wenig wie die Tatsache, dass sie in New York Sexpartys (an denen sie nur als Beobachterin teilnahm) und ein „First Homosexual Wedding“ inszenierte.
Kusama spricht von Unendlichkeit und „Selbstauslöschung“, um eins mit der Umgebung oder auch gleich mit der Ewigkeit zu werden. Und so überzieht sie alles, was ihr unterkommt, mit Kringeln und Punkte, wobei sie das Kunststück vollbringt, Gegenstände, Collagen und vor allem Mode zugleich fluxushaft, futuristisch, poppig und minimalistisch aussehen zu lassen: Handtaschen und Kleider beklebt sie mit Makkaroni, besprüht sie mit rötlicher Farbe, benäht sie mit Knubbeln und übersät sie mit Kreisen und Punkten.
Auch sie selbst taucht immer wieder auf, in Video- und Fotocollagen, Happenings und Performances in den Straßen New Yorks, in mit ernstem Blick bepunktet. In ihrer eigenen Modeboutique sieht man Kusama von nackten männlichen und weiblichen Models umgeben, deren Körper sie wie eine Zeremonienmeisterin mit bunten Punkten bemalt – doch sie selbst scheint immer außen vor, ein einsamer Fixstern in ihrem eigenen Universum.
Kusama reflektiert so viele künstlerische Richtungen gleichzeitig und nimmt andere vorweg, dass man sie heute problemlos als Frontfrau jeglicher Avantgarden der Nachkriegs- und Gegenwartskunst bezeichnen könnte. Wären da nicht Männer wie Claes Oldenburg und Andy Warhol gewesen, die ihre Ideen der „Soft Sculpture“ und des Environments klauten und damit schlagartig Markterfolge feierten, weshalb Kusama sich in New York aus dem Fenster stürzte und nur durch ein Wunder überlebte.
Sie ist eben kein Jeff Koons, keine Pop-Künstlerin, die Konsumgüter und Design augenzwinkernd in fröhliche Kunst transformiert. Ihre Grundidee ist die Unendlichkeit des Seins, das Aufzeigen der Welt als Ort grenzenloser Liebe und Verbindung. Natürlich passt das in die Hippiezeit, in die Ära der sexuellen Befreiung und in die Weltraumideen zur „Stunde Null“, wie sie von den Zero-Gruppierungen in Japan, Italien, dem Rheinland und den Niederlanden mit seriellen Formationen, Spiegeln, Rauch und Feuer zelebriert werden.
Kusama flüchtet nach Europa, weg aus dem Haifischbecken New York, wo zwar Donald Judd ihre obsessiven Wiederholungen lobt, aber ihre Arbeit als zu subjektiv abtut. Das geht in der Minimal Art natürlich gar nicht, und auch nicht in allen anderen Strömungen der nächsten Jahrzehnte. Erst, als in den 1980er-Jahren mit Louise Bourgeois die Psychoanalyse in die Kunst einzieht, wird Trauma langsam ein legitimes Studienfeld, mit dem man Kunst zu lesen beginnt. Vorsichtig geschieht das, wohlgemerkt, denn die Psyche von Künstlern soll der objektiven Bewertung des Werks ja nicht im Weg stehen. Akademisch wird das bis heute so gehandhabt, ganz so, als könne man die Person aus dem Werk verschwinden lassen, und dank KI-Kunst ist das ja vielleicht auch bald eine echte Option.
Kusama zwischen Kunst und Utopie
Doch die Tatsache, dass Kusama aus ihren Depressionen keinen Hehl machte (in einem Video taucht vor ihrem Gesicht der Satz auf: „Schluck Antidepressiva und es ist weg“) dürfte ihr damals nicht geholfen haben, ganz abgesehen davon, dass sie Rassismus und Frauenfeindlichkeit ausgesetzt war. Erschöpft lieferte sie sich schließlich selbst in die Psychiatrie ein, in der sie heute noch lebt. Auch davon liest man im Museum nicht explizit – aber vielleicht ergibt es Sinn, diese Künstlerin nicht einfach als neurodivers einzuordnen, womit man sie in die zurecht umstrittene Kategorie „Outsider-Art“ abschieben würde.
Zugleich wird ihre Biografie als eine Art Kuriosität geholfen haben, den Markt mit Großkunst zu bedienen, die immer bunter, grafischer und leider auch immer uninteressanter, weil kommerziell aussehend wird. In der Fondation Beyeler kommen deshalb die gepunkteten Besucher schönerweise erst am Ende auf Ihre Kosten. Einige Kürbisskulpturen sind hier zu sehen und Leinwände in ähnlichem Duktus, mit deren digital-halluzinativer Op-Art-Optik Kusama die Gegenwart reflektiert. Im Keller gibt es dann einen gelb-schwarz gepunkteten „Infinity-Raum“ mit aufblasbaren Skulpturwülsten samt Spiegellabyrinth, was auch eine Luxusboutique oder der Showroom eines Autoherstellers sein könnte.
Ob Kusama solche Environments tatsächlich vollständig selbst entwirft, wäre interessant zu erfahren – der fragile Touch aus ihren früheren Werken ist jedenfalls weg, und man möchte einfach nicht denken, dass der Markt die Künstlerin von ihren Depressionen geheilt hat. Doch zugleich darf man sich an denen nicht festklammern. Denn es ist Kusamas fantasievoller Umgang mit Kunst und Utopie, der sie zur herausragenden Künstlerin unserer Zeit gemacht hat.
Den inneren Schmerz in Kunst zu verwandeln, ist der Antrieb vieler großer Künstler – von Edvard Munch über Francis Bacon und Louise Bourgeois bis Tracey Emin. Dass dieser Schmerz auch Kaffeetassen und Instagram-Storys flutet, ist Teil eines Kunstbetriebs, der ohne Markt und Merchandising nicht auskommt. Umso schöner, dass Kusama hier als Pionierin einer einzigartigen, ungemein kraftvollen Vorstellungswelt gewürdigt wird, die dann am besten ist, wenn man die Angst darin noch spürt.
„Yayoi Kusama“, bis 25. Januar 2026, Fondation Beyeler, Riehen bei Basel
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke