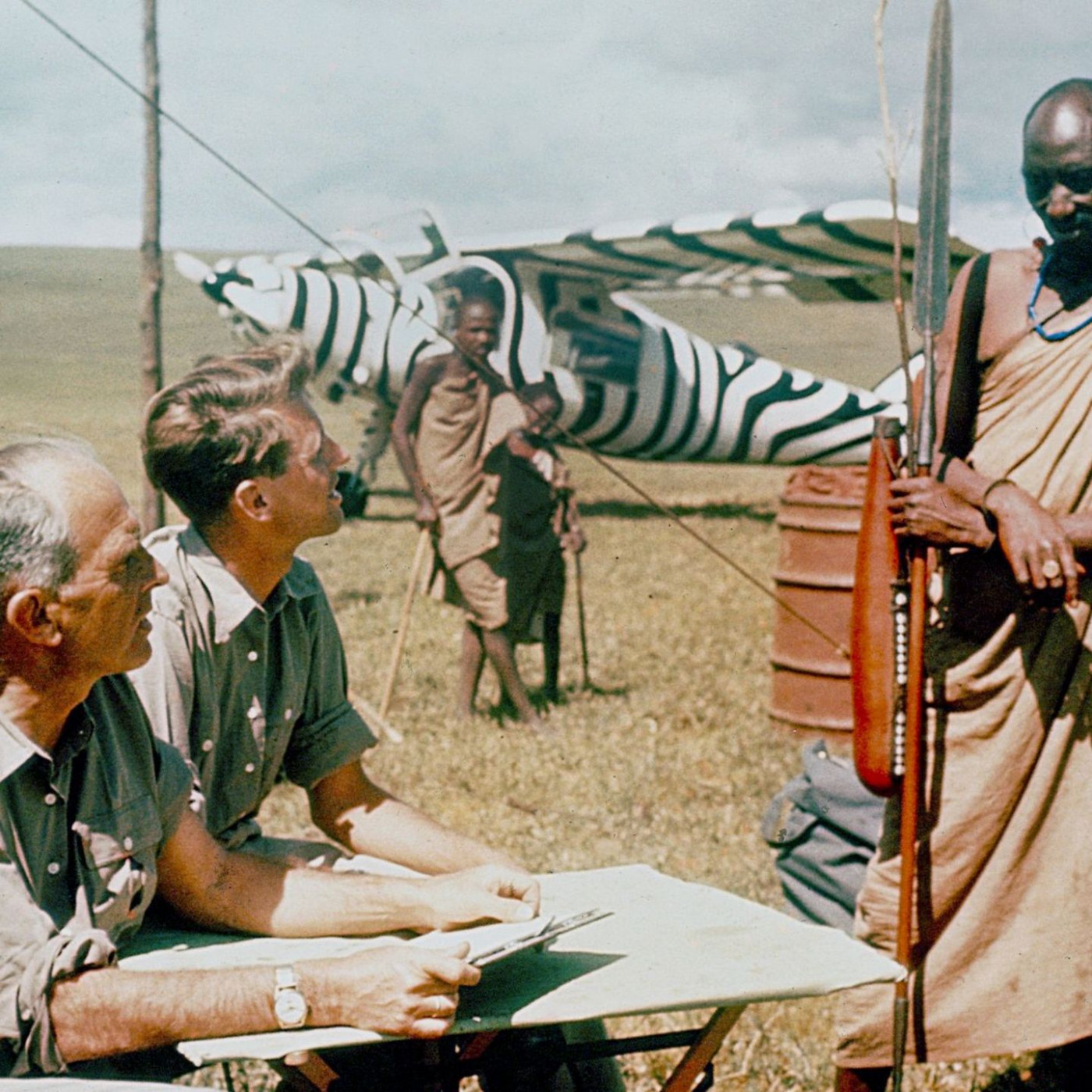Vom Feinsein singen die Frauen. Bankerlsingen nennt man das, sie tun es in der Stube, auf der Bank am Ofen, ohne Instrumente, nur für sich, ohne Männer, die würden nur stören. Vom Beinanderbleibn geht das Lied. Frisch sein soll man, singen die Frauen, „nit ummamockn“, g‘scheit sein, „nit einitappn“. Weil‘s sonst ums Leben geschehen ist und um die Liebe, was ja dasselbe ist.
Es geht sehr langsam, das Lied. Es ist wahnsinnig schön. Und wahnsinnig traurig. Fast zweihundert Jahre ist es alt. Stammt aus Tirol. Das war nicht sehr fein damals und beieinander auch nicht.
Der Film, in dem es immer wieder mal gesungen wird, handelt von einem Dorf, das nicht beinander bleibt, von den Männern, die einitappn in die Fallen ihrer Gegenwart, die nicht g‘scheit sind, von Lieben, die sterben, und von Leben, die enden.
In Oberbayern spielt sie, im Fünfseenland. Lohfing heißt der Ort, den es nicht gibt, nur im Roman „Unruhe um einen Friedfertigen“ von Oskar Maria Graf, der 1947 erschien und Vorlage war für Hannah Holligers mustergültig geschnittenes Drehbuch zu Matti Geschonnecks ZDF-Zweiteiler, der „Sturm kommt auf“ heißt.
Der Sturm, der aufkommt, ist der braune Mob, der die Macht in Deutschland übernimmt. 1918, der Erste Weltkrieg ist nicht einmal zu Ende, geht sie los. 1932, man muss selbst in Oberbayern kein großer Prophet sein, um zu wissen, was kommt, geht sie zu Ende. Und mit ihr eine Welt.
„Es ist unsere Geschichte, sie erzählt von uns“, hat Matti Geschonneck gesagt. Ihre Gegenwärtigkeit trägt sie aber nicht wie eine Monstranz bei der Fronleichnamsprozession vor sich her. Jede Zeigefingerhaftigkeit geht ihr ab. Eine sehr langsame Geschichte ist das vor allem, sehr schön und wahnsinnig traurig.
Oskar Maria Graf hat die Geschichte im amerikanischen Exil geschrieben. Vor den Nazis war er, der legendär wurde als Lederhosenträger in New York und den es wahnsinnig gefuchst haben soll, dass die deutschen Barbaren seine Bücher nicht verbrannt haben, in die USA geflüchtet.
Grafs Roman ist einer der ersten nach dem Krieg, der von der durchaus aufhaltsamen Dämmerung der Nationalsozialisten handelt. Davon, wie die Gewalt über die Menschen kam und die Menschenverachtung, wie eine Gesellschaft auseinanderbricht und warum. Und wie sie gerade jene zerreibt, zerschrotet, die sich heraushalten wollen, die Werte bewahren wollen und Menschlichkeit, die versöhnen wollen.
Nicht in Berlin, nicht in einer Metropole. Auf dem Land, also überall in Deutschland. Weswegen das Oberbayern in Geschonnecks Heimatfilm, der von Tümelei so frei ist wie von jeglicher Nazifilm-Folklore (gut gebügelte Hakenkreuz-Flaggen gibt es keine, Hitler-Reden aus jedem Lautsprecher auch nicht), genauso gut der Harz sein könnte oder die Vulkaneifel. Im Bayrischsein ist das Finale von Geschonnecks dreiteiligem Versuch über den Nationalsozialismus, seine Folgen und seine Aktualität (nach dem „Zeugenhaus“ über die Nürnberger Prozesse und „Wannseekonferenz“, der fast schon linguistischen Nachstellung der Holocaust-Planung Reinhard Heydrichs) allerdings ziemlich gut. Es ist ein doppelt ferner Spiegel, in den wir schauen und uns selbst erkennen.
Am Ortseingang von Lohfing, wo alle durch müssen, gegenüber dem Hof vom Großbauern Heingeiger steht das Haus vom Schuster Kraus. Das ist der Friedfertige. Der ist allein. Seine Frau, mit der er manchmal redet, ist tot. Sein Sohn ist in Amerika. Schon einmal ist seine Welt untergegangen. Aus Lemberg kommt er, die Pogrome, das Töten von Juden hat ihn von Galizien an die fünf Seen getrieben. Aber das weiß niemand in Lohfing.
Der Kraus ist Jude. Zum Katholizismus ist er übergetreten, das wird ihm aber nichts helfen. Registrieren hat er sich trotzdem nie lassen. Er hält sich raus. Als es darum geht, dass Lohfing einen Bürgermeister braucht, und die Idee auftaucht, doch den Kraus, den alle mögen, der alle versöhnen könnte, zum Ortsvorsteher zu machen, wird er krank. Solange, bis er glaubt, dass der Sturm vorüber sei.
Die Elies liebt er, aber das sagt er nicht. Die Elies ist die Tochter des Heingeiger. Von einem Russen hat sie ein Kind. Der Russe ist weg. Peter heißt der Junge. Der Kraus ist ihm wie ein Vater. Vielleicht wäre alles anders gekommen, wenn nicht der Silvan heimgekehrt wäre. Der ist der Sohn des Heingeiger. Ein feister Kerl. Hat in der Etappe den Krieg überlebt. Und die Gewalt gelernt. Und wie sie die Welt verändert.
Jetzt ist er wieder in Lohfing. Sein Gesicht besteht überwiegend aus Zähnen. Es dauert nicht lang, da stapeln sich, wo er sitzt und trinkt und feixt, die Leichen. Die Elies möchte er weghaben. Irgendwann, da hat der Silvan sie von einem seiner Kumpels vergewaltigen lassen, tut sie ihm selbst den Gefallen und hängt sich auf. „Sturm kommt auf“ ist ein entsetzlicher Film.
Vielleicht sollten wir jetzt erstmal über die Gesichter reden. Geschonnecks „Wannseekonferenz“ war ein geradezu peinigendendes Sprachexperiment, die Analyse einer Sprachmechanik, eines pervertierten Sprechaktes über die Industrialisierung des Massenmordes, dessen Ähnlichkeit mit gegenwärtigen Aufsichtsrat- und Vorstanddebatten eklatant war.
In „Sturm kommt auf“ reden alle wenig. Die Bilder sagen fast mehr. Sie sind in leichtem Sepia gehalten, bei den Nazis werden sie kälter. Die Berge sind immer da und schauen dem zu, was da geschieht. Eine Wegkreuzung hat es auf dem Weg in die Stadt. Ein Jesus hängt da in der Mitte am Kreuz. Er würde mit den Schultern zucken, wenn er nur könnte.
Gesichter sagen alles
Menschen werden sehr klein in der Landschaft. Was sie zu sagen hätten, sagen ihre Gesichter. Das vom Schuster (Josef Hader ist der Kraus und man möchte ihn ständig in den Arm nehmen), der immer so schaut, als wäre hinter ihm irgendwas, was irgendwann ja auch stimmt. Oder das von der Elies, über das Verena Altenberger ganze Romane huschen lässt. Oder das vom Silvan, das Frederic Linkemann in allen Farben der Boshaftigkeit leuchten lässt. Die Kamera von Theo Bierkens liebkost sie alle. So schrecklich wie sie manchmal sind.
Es geht um Gier in diesem Film. Um das Versagen der Obrigkeit, um Wendehälse und Widerständler. Um die Gewalt, vor der sich die Menschlichkeit beugt, was sie gar nicht müsste. Um die Entscheidungen eines jeden Einzelnen und wie sie dazu beitragen können, Zeitläufte zu verändern. Insofern ist „Sturm kommt auf“ natürlich eine Geschichte, die von uns erzählt, ein Menetekel. Er ist der vielleicht schönste, mit Sicherheit aber wahrhaftigste Fernsehfilm des Jahres.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke