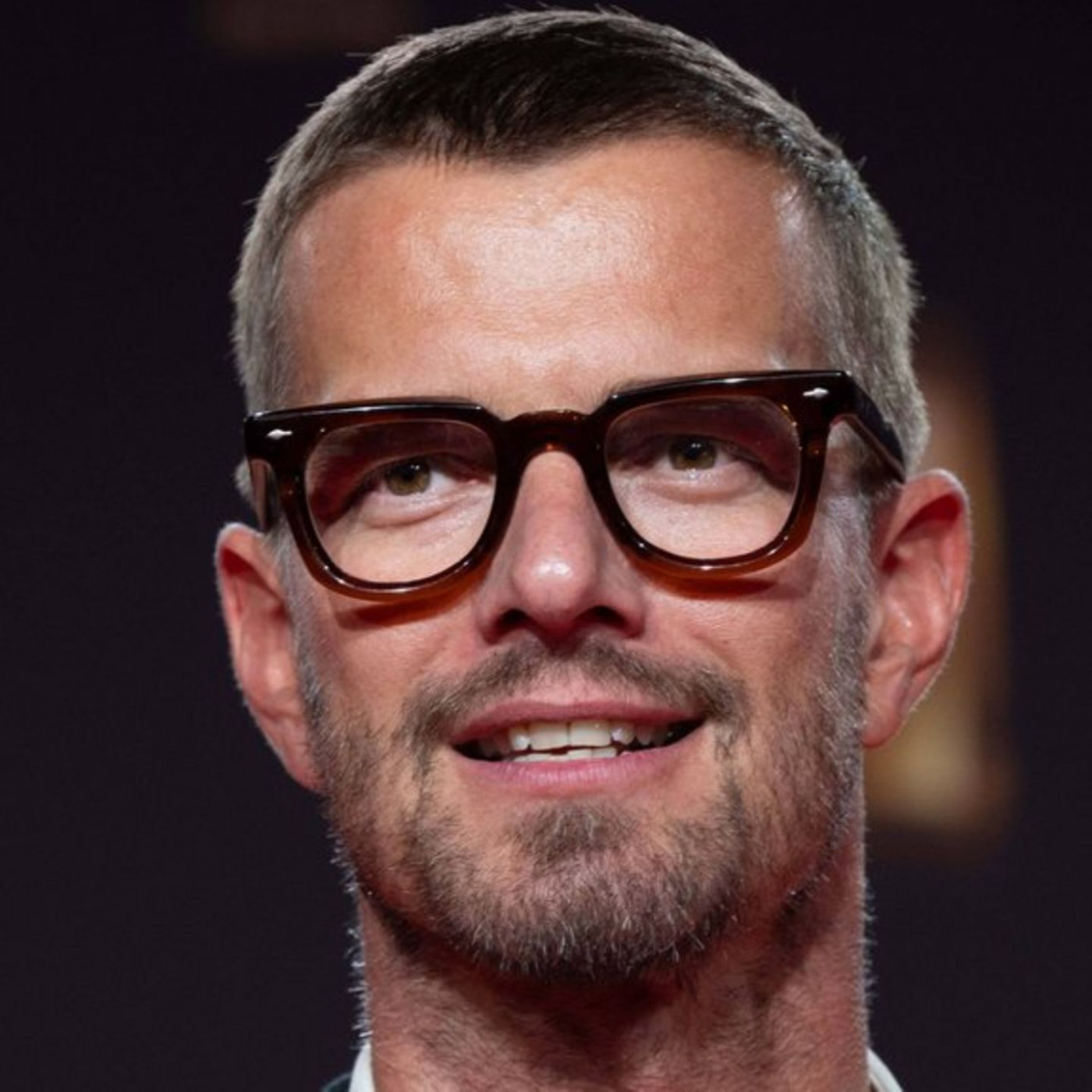Auf eine unscheinbare Betonwand in einem abgelegenen Winkel von Hamm sprayte der Streetart-Künstler Kai Wohlgemuth aka Uzey im Frühjahr 2020 ein Graffito, das um die Welt ging. Zu sehen war eine Krankenschwester mit Mund-Nasen-Schutz und Häubchen, die ein Superman-Emblem auf der Brust und einen Strahlenkranz um ihr Haupt trug. „Für die echten Helden“, schrieb Uzey daneben und meinte damit all jene, die im Gesundheitswesen Dienst taten und während der Corona-Pandemie die Stellung hielten.
Ein Foto des Wandbildes ist von 29. Oktober an in der Ausstellung „Care! Wenn aus Liebe Arbeit wird“ im Museum der Arbeit zu sehen. Wie die Pandemie so dramatisch zeigte, ist unsere Gesellschaft auf fürsorgende Personen angewiesen: Rund fünf Millionen Menschen sind in Deutschland in der Pflege beschäftigt. Doch die Schau widmet sich nicht nur der – meist – unterdurchschnittlich bezahlten, sondern auch der unbezahlten Care-Arbeit sowie dem Bereich Pflege und Migration. „Die Ausstellung möchte Impulse geben, um das gesellschaftliche Leben zu verbessern“, erklärt Mario Bäumer, der mit Jenni Boie und Luisa Hahn das kuratorische Team bildet.
Die unbezahlte und dadurch oft unsichtbare Pflege- und Hausarbeit wird weltweit etwa dreimal häufiger von Frauen als von Männern verrichtet: von Müttern, Haus- und Ehefrauen oder von Pflegerinnen eines greisen Elternteils. „Der Fokus liegt auf der strukturell ungleichen Verteilung von Care-Arbeit“, sagt Boie über das Phänomen „Gender Care Gap“. Profane Alltagsobjekte symbolisieren im Museum die Hausarbeit: eine Kaffeemaschine, eine Rohrzange, ein Windelpaket, eine Klobürste.
Weites Tätigkeitsfeld, unterschiedliche Perspektiven
Das weite Tätigkeitsfeld wird aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. Zu den Exponaten gehören historische Objekte, persönliche Erfahrungsberichte und Gegenstände, Zahlen, Statistiken und Dokumente sowie künstlerische Interventionen. Die Künstlerin Josefine Flora Green setzt sich kritisch mit der Ökonomie in der Ehe auseinander und nähte Boxhandschuhe aus ehemaligen Hochzeitskleidern. Die Ungleichheit der gesellschaftlich festgelegten Aufgaben von Mann und Frau – er geht arbeiten, sie hält ihm zu Hause den Rücken frei – war als bürgerliches Ideal lange im Bewusstsein verankert.
Weil Kinderpflege und Erziehung meist Frauensache ist, bedeutet Berufstätigkeit in der Regel eine Doppelbelastung. Die Künstlerin Clara Alisch zeigt in ihrer Videoarbeit „Lactoland“ eine Frau beim Abpumpen von Muttermilch, daneben steht ein Glas mit weißen Bonbons, die scheinbar aus dieser Babynahrung hergestellt wurden. Aus der Museumssammlung stammen verschiedene historische und moderne Milchpumpen, darunter das DDR-Exemplar „Pneumant“ von 1980.
Die Ungerechtigkeit in Sachen heimischer Care-Arbeit wird schon seit über einem halben Jahrhundert diskutiert und kritisiert: Historische Protestplakate werben für die Aktionen der internationalen Kampagne „Lohn für Hausarbeit“ („Wages for Housework“), die 1972 unter anderem von der italienisch-amerikanischen Feministin und Philosophin Silvia Federici ins Leben gerufen wurde. Die Bewegung vertrat die Ansicht, dass die häuslichen Care-Arbeiten grundlegend für die kapitalistische Produktionsweise sind und entsprechend entlohnt werden müssen. Aus Federicis Schriften stammt der Satz: „Sie nennen es Liebe. Wir nennen es unbezahlte Arbeit“, auf den sich der Ausstellungstitel bezieht.
Ein Begriff, den die Frauenbewegung geprägt hat, lautet „Reproduktionsarbeit“. Damit sind Tätigkeiten gemeint, die dem Erhalt der Arbeitsfähigkeit und der Sicherung der Bevölkerung dienen – also Schwangerschaft und Geburt, Erziehung, Betreuung und Versorgung von Kindern, Partnern und Angehörigen.
Die innere To-Do-Liste wird nachvollziehbar
Zur reproduktiven Tätigkeiten zählt auch die Übernahme von Verantwortung in Form einer geistigen Last („Mental Load“), also einer inneren To-do-Liste, deren Posten im Kopf kumulieren. Im interaktiven Bereich der Schau, der Besucher-Austausch und Meinungsbildung fördern will, liegen Kopfhörer bereit, durch die eine solche Liste angehört werden kann. Der innere Stress wird dabei nachvollziehbar.
Im Kapitel über die bezahlte Care-Arbeit geht es unter anderem um das Thema Pflegenotstand, der Krankenhäuser, Pflegeheime und ambulante Dienste betrifft. Laut Statistischem Bundesamt werden in 25 Jahren deutschlandweit rund 280.000 Pflegekräfte fehlen. Dieser Mangel ergibt sich einerseits aus dem demografischen Wandel. Andererseits wandern die Fachkräfte in andere Berufe ab: Die belastende, schlecht entlohnte Care-Arbeit ist naturgemäß nicht sehr attraktiv.
So stellt sich die Frage, ob der Einsatz von Pflegerobotern, die fehlendes Personal ersetzen sollen, sinnvoll und ethisch vertretbar ist. Zu sehen ist etwa die Sattelrobbe „Paro“, ein 60 Zentimeter langer Roboter mit flauschigem Fell, Kulleraugen und der Fähigkeit, bei Berührung wohlige Geräusche auszustoßen. Die Pflegerobbe wird deutschlandweit schon als Therapiemittel vor allem in der Betreuung demenzkranker Menschen eingesetzt. Sie soll bei den Betroffenen positive Emotionen auslösen und sie zum Sprechen anregen.
Ein besonderer Fokus liegt im Museum auf der Rolle von Migration: „Durch den Pflegenotstand sind wir abhängig von migrantischen Kräften. Das System basiert darauf, dass es diese Kräfte gibt“, erklärt Kuratorin Luisa Hahn. Zum Beispiel wechselten infolge des 1971 geschlossenen Anwerbeabkommens zwischen Deutschland und Südkorea etwa 10.000 qualifizierte koreanische Krankenschwestern in die Bundesrepublik. Heute kommen viele Migrantinnen ins Land, um in Privathaushalten als Haushalts- oder Pflegehilfen zu arbeiten – oft unter ausbeuterischen Bedingungen. Eine Videoarbeit von Brigitte Dätwyler und Lena Thüring schildert den Alltag von fünf Pflege-Migrantinnen.
Zum Thema gehört auch das Prinzip der globalen Sorge-Ketten. Während Frauen in fremden Ländern Care-Arbeit übernehmen, entstehen in ihrer Heimat Sorge-Lücken, die von weiblichen Verwandten oder von anderen Care-Arbeiterinnen gefüllt werden. Die philippinische Dokumentarfotografin Xyza Cruz Bacani, die selbst in Hongkong als Hausangestellte tätig war, verfolgt in einer Fotoserie den Weg eines der typischen Care-Pakete voller Konserven, Kleidung und Andenken, die von den philippinischen Wanderarbeiterinnen an ihre zurückgelassenen Kinder geschickt werden. Auch diese Frauen könnte man als „echte Heldinnen“ bezeichnen.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke