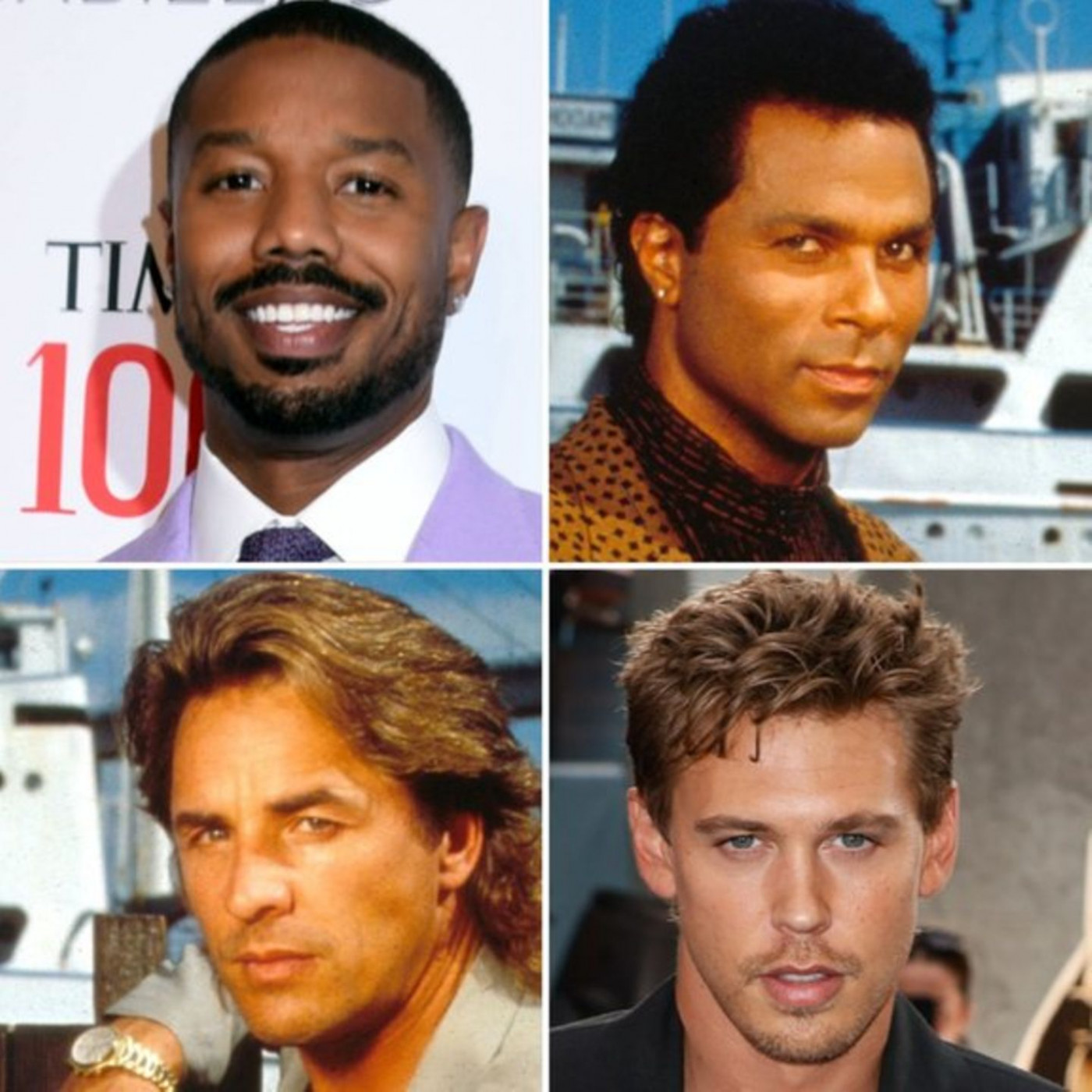Achtjährigen Mädchen kann man vieles verzeihen. Auch ihre zeitweilige Obsession für magische Kuscheltiere, fantastische Fabelwesen und sonstigen Polyesterplüsch. Zum Glück ist die Leidenschaft unserer Tochter für Einhörner längst abgeflaut, bevor sie richtig aufflammen konnte. Die beiden Exemplare – es sind wirklich nur zwei! – liegen die meiste Zeit unbeachtet am Fußende des Betts (das große, schöne, weiße Pferdeartige) oder als Staubfänger darunter (das kleine, hässliche, buntgescheckte aus der Familie der Glubschäugigen). Die Frage, welches dem „wirklichen“ Einhorn näher ist – die groteske Chimäre oder der gehörnte Schimmel –, stellt sich die Achtjährige nicht.
Und, ja: Natürlich gab es Einhörner! Jedenfalls bis in die frühe Neuzeit hat kaum jemand ihre Existenz angezweifelt. In der Bibel ist schließlich an acht Stellen von jenem wilden Tier die Rede. Dessen Gestalt wandelte sich jedoch mit jeder Übersetzung: Das hebräische re’em wurde zum griechischen monoceros, zum lateinischen unicornis und schließlich bei Luther zum Einhorn. Erst moderne Rationalisten tilgten das Wesen aus der Bibel – und ließen im Psalm 22 lieber Löwen gegen „gehörnte Stiere“ kämpfen.
Auch in der um 50 n. Chr. verfassten „Naturgeschichte“ des Plinius des Älteren nimmt das Einhorn seinen Platz ein. Es sei „das beliebteste Jagdtier der Inder“, mit dem Körper eines Pferds, dem Kopf eines Hirschs, mit Schweineschwanz, Elefantenfüßen, Ziegenbart und einem zwei Ellen langen Horn. Im frühchristlichen „Physiologus“ schrumpft das Wesen zwei Jahrhunderte später auf Ziegengröße. Dass seine Stimme laut und unangenehm war, hatte schon der griechische Arzt Ktesias von Knidos im 5. Jahrhundert v. Chr. bestätigt. Indien musste er auch gar nicht bereisen, um zu behaupten, das scheue Tier sei außerdem schwer zu fangen.
Mit vielen antiken und biblischen Quellen war das Einhorn in der Welt – und die ersten Weltreisenden berichteten eifrig, es gesichtet zu haben. „Auf Klein-Java leben viele wilde Elefanten und Einhörner, die kaum kleiner als Elefanten sind“, schreibt Marco Polo um 1298 und nennt sie „ausgesprochen hässlich. Diese Tiere haben mit unseren Einhörnern gar nichts gemein.“ Bei diesem eleganten Schwenk aus der asiatischen in die europäische Fauna bräuchte es nicht einmal harte Fakten, um die Authentizität des Einhorns zu beglaubigen.
Doch auch die gab es: in Gestalt angeblich echter Hörner. Weiß und schlank, spiralig gedreht, spitz wie eine Lanze tauchten sie immer mal wieder auf, wurden mit Gold aufgewogen, zu Arznei zermahlen oder in Kirchen aufgestellt, wie das zweieinhalb Meter lange „Einhornhorn“ in der Kathedrale von Saint-Denis.
Kein Wunder also, dass das Einhorn Künstler seit Jahrhunderten fasziniert. Der Historiker Michael Philipp, Chefkurator am Museum Barberini in Potsdam, hat diese Spur systematisch verfolgt – und erstmals eine große Ausstellung daraus gemacht. Dem kommerziellen Hype der vergangenen Jahre – von Einhornglitzeraufklebern bis zum „Unicorn Frappuccino“ – setzt Philipp eine kulturhistorische Tiefenbohrung entgegen.
Der Mythos trieb schon im Mittelalter bunte Blüten. Auf einer oberrheinischen Tapisserie von 1440 stolzieren „symbolische Tiere“ – Löwe, Hirsch, der fabelhafte Greif und ein schwarzes, getupftes Einhorn. Fünfzig Jahre später zeigt ein weiterer Wandteppich vier „allegorische Tiere“ mit Spruchbändern, darunter das Einhorn, das mit ironischer Selbstgewissheit verkündet: „Gott muss alles erschaffen haben“ – also auch sich.
Von der Antike bis in die Renaissance gehörten Einhörner selbstverständlich zur tradierten Fauna. Doch am Beginn der Neuzeit machte sich Skepsis breit. Der Schweizer Zoologe Konrad Gesner kam in der ausführlichen Betrachtung des Einhorns in seiner „Historia animalium“ zu dem Schluss: „Aber Genaueres weiß ich nicht.“ Spätestens im 17. Jahrhundert glaubte niemand mehr an das Tier. So fassen es der Altphilologe Bernd Roling und die Literaturwissenschaftlerin Julia Weitbrecht in ihrem Buch „Das Einhorn. Geschichte einer Faszination“ (Hanser, 2023) zusammen.
Die fulminante Ausstellung im Museum Barberini verfolgt die künstlerische Karriere des Fabelwesens: vom ältesten Nachweis, einem winzigen Einhorn-Siegel aus der Indus-Kultur (ca. 2000 v. Chr.), über dessen Bedeutung auch die Experten nur spekulieren können, zu mittelalterlichen Miniaturen und Renaissancegemälden bis zu Rebecca Horn, die sich in Performances der 1970er-Jahre selbst das Horn aufsetzte.
Während Mystiker des 12. Jahrhunderts noch über den Charakter des Einhorns grübelten, lag es in manchen illuminierten Schöpfungsgeschichten des 15. Jahrhunderts schon Adam und Eva zu Füßen. Der Renaissancemaler Hans Baldung Grien stellte „Die Erschaffung der Menschen und Tiere“ um 1533 in einem großartig komponierten Simultanbild dar. Unten formt der bildhauerisch begabte Gott Adam aus einem Fels, darüber hilft er hebammengleich Eva dabei, aus Adams Lende zu schlüpfen und oben kreiert er mit dramatischer Geste allerlei Getier. Das Einhorn aber hat sich direkt vor Gottvater aufgebaut. Schließlich wurde es in dieser Übergangszeit längst als Symbol Christi verstanden.
In Darstellungen der Verkündigung sieht man nun auch Maria häufiger mit einem Einhorn in ihrem Schoß. Was es dort zu suchen hat, erzählt ein antikes, frühchristliches wie islamisches Narrativ neu: Weil die Einhörner so scheu und wild waren, reizten sie die Menschen umso mehr, sie zu jagen – ein verlustreiches Unterfangen. Dann stellte man fest, dass nur eine Jungfrau imstande war, das Einhorn zu zähmen.
Dem Marienkult bot diese Dreifaltigkeit von Jagd, Jungfräulichkeit und Zähmung eine willkommene Möglichkeit, ein theologisches Problem zu erklären. Das eine Horn bezeichne den einen Gott, heißt es im „Physiologus“. In der Unnahbarkeit des Einhorns erkenne man das göttliche Geheimnis und die Inkarnation Jesu.
Aber erst das einprägsame Bild von der Jungfrau, die das Einhorn anlockt, zähmt und mitunter sogar säugt, veranschauliche laut Roling und Weitbrecht „den körperlichen und zugleich nicht körperlichen Vorgang der Empfängnis“ der unbefleckten Jungfrau Maria. Im Museum Barberini macht eine „Mariä Verkündigung in der Allegorie der Einhorn-Jagd“ aus dem Erfurter Dom diese Interpretation deutlich. Das zutrauliche Tier, hier in Gestalt eines Rehs mit gespaltenen Hufen, springt geradezu in den Schoß der Gottesmutter, die dessen Einhorn liebevoll umfasst. Der Erzengel Gabriel bläst dazu in sein Horn, um die frohe Botschaft zu verkünden.
Aus der frommen – unterschwellig sexualisierten – Ikonografie wanderte das Motiv bald in die profane. Dario di Giovanni etwa porträtierte die Venezianerin Caterina Corner als „Allegorie der Keuschheit“. Die prächtig gewandete Dame sitzt auf dem Gemälde von 1467/68 auf einer Blumenwiese und umarmt das neben ihr ruhende Einhorn, den eindrucksvoll gehörnten Kopf wendet das Tier sittsam ab.
Luca Longhi malte eine ähnliche Szene um 1540 mit manieristischem Witz. Provokant blickt die junge Frau, die in eine edle Damastdecke gehüllt ist, aber darunter die Marienfarben Rot und Blau trägt, in Richtung des Betrachters. Das ungeduldige Einhorn neben ihr ist nur mit autoritären Gesten zu bändigen.
Die Komposition des Gemäldes geht auf eine Zeichnung von Leonardo da Vinci zurück, in dessen Bestiarium das Einhorn als Sinnbild für die Unbeherrschtheit steht. Das Pikante an der Darstellung: Hier ist wohl Giulia Farnese porträtiert, genannt „la bella“, die Geliebte des für seine aufrichtige Marienverehrung wie seinen ausschweifenden Lebenswandel berüchtigten Borgia-Papstes Alexander VI.
Böcklin: „Hast du jemals ein Einhorn gesehen?“
Zur genüsslichen Ausbreitung des Einhorns im Museum Barberini gehört auch die lustvolle Dekonstruktion seines Mythos im Laufe der Zeit. Die Sache mit dem Horn zum Beispiel: Was jahrhundertelang als seltener Beweis für die unicorne Echtheit galt, wurde bald in größerer Stückzahl aus Skandinavien eingeschifft und zog in jede höfische Kunstkammer ein, als das, was es ist: eine exotische Naturalie, aber eben kein Einhornhorn, sondern ein Narwalzahn. Das riesige Exemplar aus Saint-Denis ist in der Ausstellung zu sehen.
Oder die Sache mit dem Aussehen: Irgendwann degradierte man das mysteriöse Einhorn zum reitbaren Pferd, dem als Maskerade ein gehörnter Stirnharnisch aufgesetzt wurde. Und als Arnold Böcklin es im späten 19. Jahrhundert aus dem Schlummer des kollektiven Bildgedächtnisses wieder auf die Leinwand zerrt, verleiht er dem einst edlen Wesen die Gestalt einer zotteligen Kuh. „Hast du jemals ein Einhorn gesehen“, soll er nur entgegnet haben, als er dafür kritisiert wurde.
Mittlerweile scheint das Einhorn ganz unten angekommen zu sein. Als plüschiger Wolpertinger, für den sich nicht mal Achtjährige mehr interessieren. Als gefühliger Identifikationsmarker für die Generation Z. Der Potsdamer Kurator Michael Philipp will seine Ausstellung bewusst nicht heute enden lassen. Für ihn bäumt sich das Fabeltier ein letztes Mal im Zeichentrickfilm „The Last Unicorn“ von 1982 auf.
Von da an ist das Einhorn der Treibjagd des Kommerzes ausgeliefert. Seit 2015 gibt es sogar ein Unicode-Emoji. Mit seinem ahnungslosen Blick, der pinken Mähne und dem regenbogenfarbigen Horn ist dieses digitale Ungeheuer der eigenen Kulturgeschichte beraubt.
„Einhorn. Das Fabeltier in der Kunst“, bis 1. Februar 2026, Museum Barberini, Potsdam; Katalog 49 Euro (Prestel)
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke