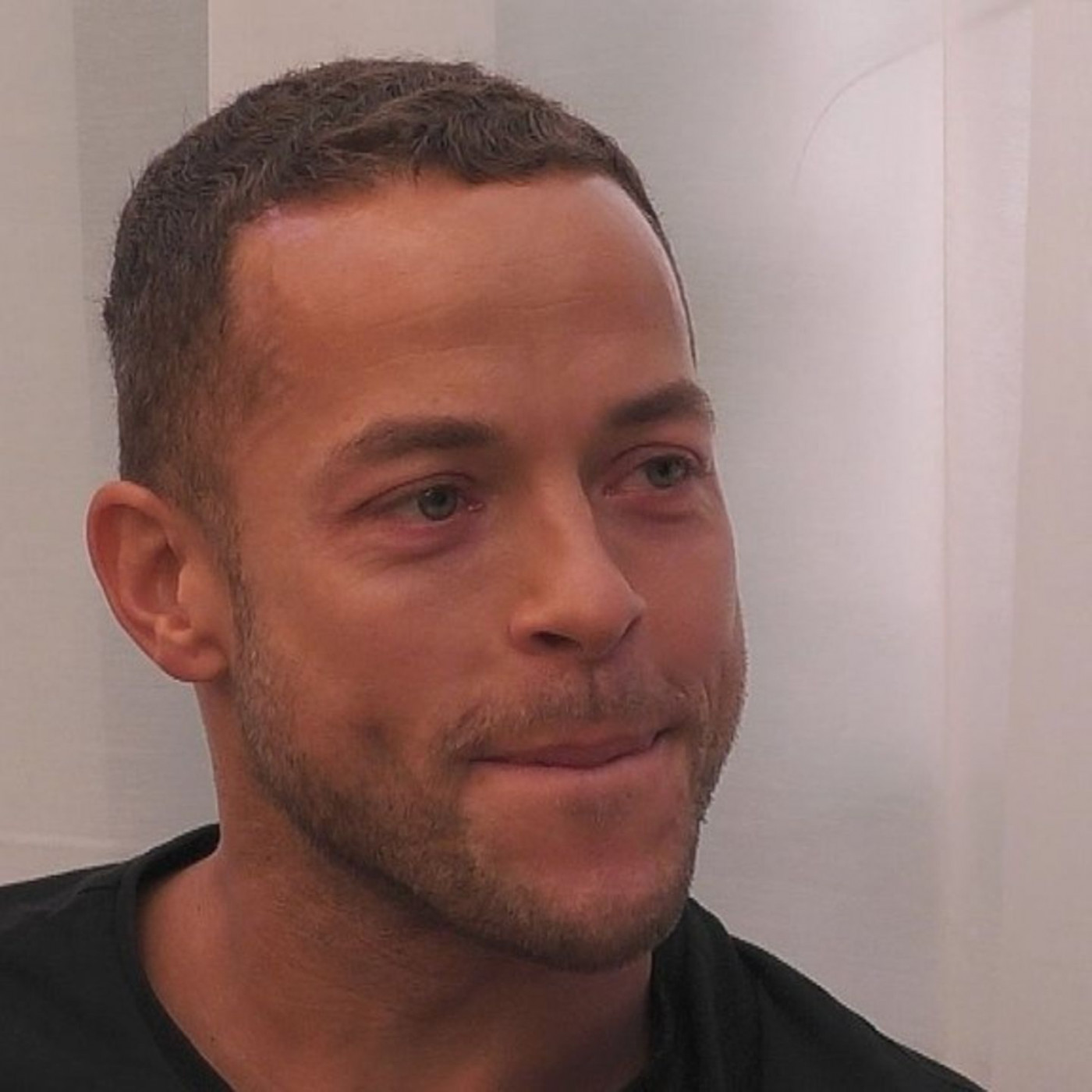Der italienische Regisseur Luca Guadagnino gilt als einer der feinfühligsten Erzähler des zeitgenössischen Kinos. Seine Filme – von „I Am Love“ über „Call Me by Your Name“ bis zuletzt „Queer“ – sind geprägt von einer intensiven Sinnlichkeit und einer seltenen Balance zwischen Intellekt und Emotion. In seinem neuen Film „After the Hunt“, der in diesem Jahr im Wettbewerb von Venedig außer Konkurrenz lief, führt der 54-Jährige diese Linie fort: In dem Drama geht es um Wahrheit und Wahrnehmung, als eine Studentin einen befreundeten Dozenten der sexuellen Gewalt beschuldigt und ihre Professorin sich positionieren muss. Besondere Aufmerksamkeit bekam das Werk durch Guadagninos Cast, allen voran Hauptdarstellerin Julia Roberts.
WELT: Julia Roberts ist in diesem Drama nicht nur als Mittelpunkt einer elitären Uni-Clique die perfekte Protagonistin, sondern auch als Magnet für weltweite mediale Aufmerksamkeit. Was genau machte sie für Sie zur idealen Hauptfigur? Luca Guadagnino: Die Figur der Alma stach im Drehbuch auf eine so kraftvolle, beharrliche Art hervor, dass sie mich an die großen Charaktere des klassischen Kinos erinnerte, das ich sehr liebe. Figuren, wie Joan Crawford, Bette Davis oder Faye Dunaway sie gespielt haben könnten. Für mich strahlte diese Rolle sofort Ikonenhaftigkeit aus. Und Julia ist nun mal einer der größten Stars von Hollywood – nicht nur der Gegenwart, sondern auch in der gesamten Geschichte Hollywoods. Ich bin mit dem Kanon ihrer Filme und ihrer fast magischen Anziehungskraft aufgewachsen. Als sich mir die Möglichkeit bot, sie zu treffen und über dieses Projekt zu sprechen, empfand ich das sofort als großes Glück. Dann stellte sich heraus, dass wir zum Drehbuch von Nora Garrett sehr ähnliche Gedanken entwickelt hatten, und daraus ergaben sich sofort tiefe, komplexe Gespräche.
WELT: Ihre Figur Alma, eine Philosophieprofessorin in Yale, hat deutsche Wurzeln. Warum? Guadagnino: Wir fanden eine Herkunft aus dem Land Adornos bedeutsam. Es sollte klar sein, dass sie geistig aus dieser Erblinie entstammt. Außerdem impliziert es, dass die Figur auch ein wenig entwurzelt ist, ein wenig deplatziert. Sie gehört dazu und dann doch wieder nicht. Das empfinde ich als etwas sehr Amerikanisches. WELT: Ihr Film beginnt in Almas Haus, an einem Abend mit lustvoll debattierenden Intellektuellen. Porträtieren Sie mit dieser elitären Blase ein Ideal? Ihr Ideal?  Guadagnino: Nein. Als ich „I am Love“ drehte, glaubten viele, ich sei selbst Teil der vornehmen Mailänder Industriellen-Bourgeoisie oder wäre zumindest in diese Welt verliebt und wollte sie glorifizieren. Dabei ist es doch schlicht das Privileg eines metteur en scène, eines Regisseurs, Welten zu erschaffen. Es ist einer der größten Freuden meines Berufs, Menschen und Welten zum Leben zu erwecken. WELT: Das klingt gottähnlich. Gibt es dennoch unter den vielen Welten, die Sie erschaffen, eine bevorzugte?
Guadagnino: Es mag etwas schamlos anmuten: Aber die Welt, die ich allen anderen vorziehe, ist die Welt meines Zuhauses. Da, wo ich in der Küche stehe und für meine Freunde und meinen Partner koche, und wo ich sonst die Zeit ausschließlich damit verbringe, Bücher zu lesen. Das ist meine Welt.
WELT: Freundschaften, Wahlverwandtschaften haben für Sie selbst einen extrem hohen Stellenwert. Sie arbeiten meist mit Bekannten, um, so haben Sie gesagt, damit „Konflikte am Set zu vermeiden“...
Guadagnino: Konflikte entstehen nur, wenn es an Verständnis und Zuhören mangelt. Es stimmt, ich arbeite mit einigen Personen schon seit drei Jahrzehnten zusammen. Mit diesen Vertrauten habe ich die Möglichkeiten, die das Kino dir gibt, schon so intensiv erkundet, dass es uns erlaubt, sowohl Unverständnis als auch Missverständnisse zu vermeiden. Wir streben gemeinsam nach Großartigkeit – so können wir doch ehrgeizige Ziele viel wahrscheinlicher erreichen.
WELT: Dennoch hatten Sie hier viele neue Gesichter dabei, neben Roberts auch Ayo Edebiri und Andrew Garfield. Ging es nun konfrontativer zu?
Guadagnino: Ich glaube, ich lasse mich bei den Menschen, mit denen ich gerne arbeiten möchte, durch meine Intuition leiten – und durch Begehren. Das Begehren ist eine Kraft, die nicht kontrollierbar ist und die die Intuition leitet. Ich hoffe, dass die Intuition dieser Menschen ihnen wiederum suggeriert, dass ich der Richtige für sie bin. Ich sehe jemanden wie Andrew Garfield in „Von Löwen und Lämmern“ auf der Leinwand, unter der Regie des großen Robert Redford, und denke in dem Moment: Diesen Schauspieler will ich unbedingt kennenlernen.
WELT: „After The Hunt“ beschäftigt sich mit einem möglichen sexuellen Übergriff – und heftigen Konflikten, vermeintlicher Manipulation und divergierenden Meinungen. Sie nennen es „subjektive Wahrnehmungen“. Ist das nach MeToo zulässig? Ist das Spiel mit Wahrheiten für Sie nur eine intellektuelle Übung
Guadagnino: Hoffentlich nicht – ich hoffe inständig, nie ausschließlich intellektuelle Übungen zu machen! Ich will Strukturen schaffen, Geschichten formen, mit den Mitteln des Kinos Impulse geben. Für mich ist „After the Hunt“ ein moralischer Thriller, ein Labyrinth aus Geheimnissen und enthüllten Wahrheiten. In dieser Dynamik muss das Publikum selbst entscheiden, was es selbst für die Wahrheit hält.
WELT: Spinnen wir den Gedanken weiter: Wenn die Wahrheit von subjektiven Wahrnehmungen ersetzt wird, wohin steuert unsere Gesellschaft? In eine „fake democracy“?
Guadagnino: Hah! Natürlich ist alles komplexer. Wir leben in einer Zeit, in der der Mehrheit eine Meinung mittels Social Media als Wahrheit verkauft wird. Das 20. Jahrhundert ist vorbei, und mit ihm die Vorstellung, dass der moralische Kompass von Intellektuellen geprägt wird. Heute ist jede Meinung valide, auch wenn sie von der unsichtbaren Hand und einem Konsens der Mehrheiten gesteuert wird. Das gilt für Demokratien und Nichtdemokratien. WELT: Sie denken, dass soziale Medien unseren Realitätssinn verbiegen?
Guadagnino: Unsere Identitäten werden von der Allgegenwart des Digitalen so stark geformt, dass wir nicht bemerken, dass wir nur noch „agiert werden“ anstatt zu agieren. Mit künstlicher Intelligenz wird es noch brisanter: Wir sehen ein Video und wissen nicht mehr, ob es echt ist oder KI. Die Grenzen zwischen Wahrheit und Unwahrheit verschwimmen und verwirren immer mehr. Noch hinterfragen wir. Aber morgen vielleicht nicht mehr.
WELT: Macht Ihnen die Vorstellung Angst, dass wir das Hinterfragen aufgeben könnten?
Guadagnino: Ich wünsche mir sehr, dass wir weiterhin – oder nun erst recht – das Gespräch suchen. Dass wir den Austausch wiederbeleben. Dass Menschen reden, ohne sich zensiert zu fühlen. Nur so bleibt Wahrheit ein Prozess für alle.
„After the Hunt“ ist am 16. Oktober 2025 in deutschen Kinos angelaufen.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke