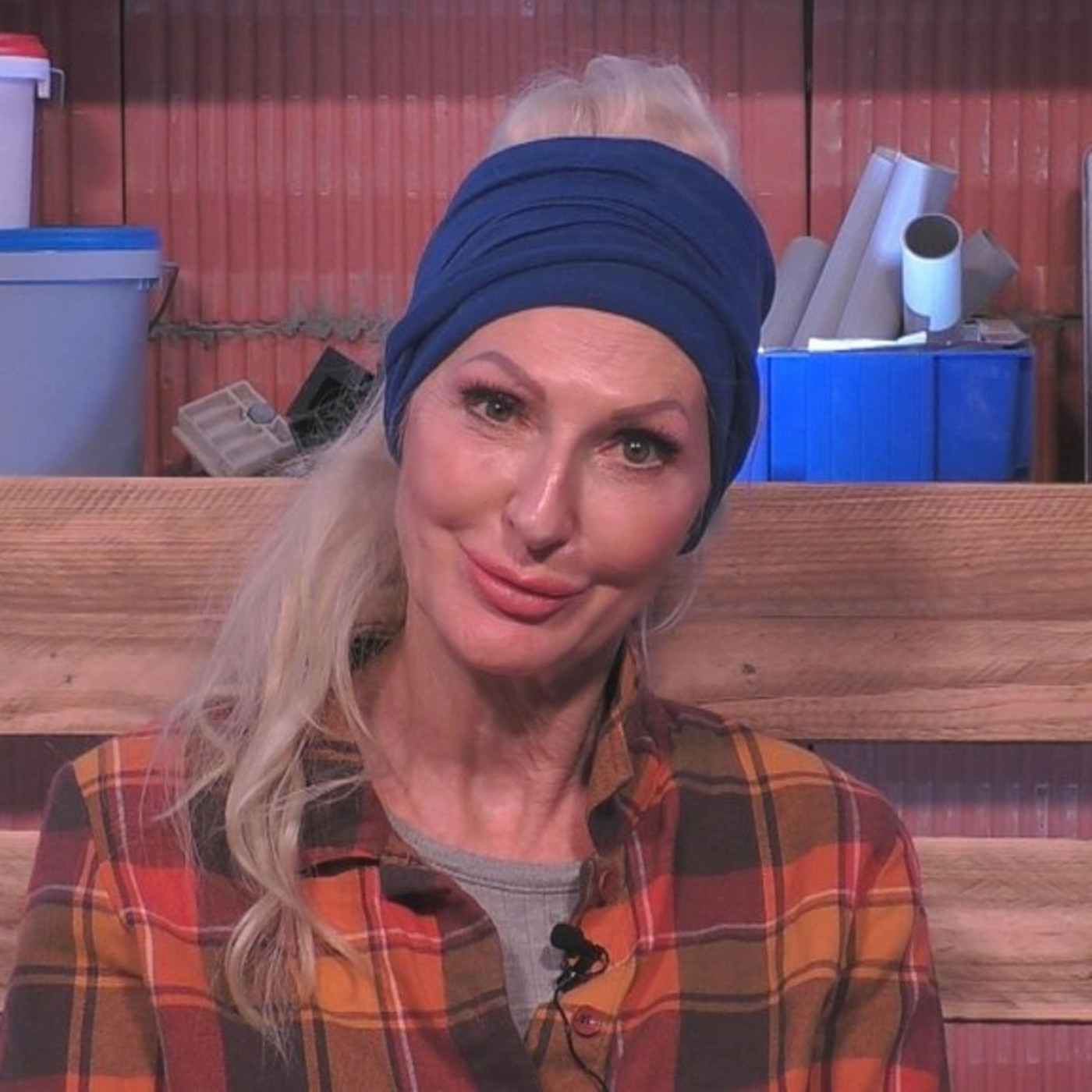Was bleibt vom rasch und kriminell gewachsenen Imperium des Tiroler Aufsteigers René Benko? Ein Berg Schulden, Bauruinen in verödeter City-Bestlage, eine protzige Behausung auf den Ruinen eines Grand Hotels in Innsbruck-Hungerburg und eine mit Bling-Bling-Requisiten ausgestattete Villa am Gardasee, durch die gerade die Bieter zwecks Interieursversteigerung stapften.
Auch die österreichische Familie Eggenberg, ein Patriziergeschlecht aus Graz, war Anfang des 17. Jahrhunderts schnell zu Macht, Ehre und sehr viel Geld gekommen. Nicht immer auf dem allerehrlichsten Weg. Denn der 1623 gefürstete Hans Ulrich von Eggenberg war zum wichtigsten Berater, ja Freund Kaiser Ferdinands II. herangewachsen und wurde für seine loyalen, bisweilen unsauberen Dienste imperial belohnt. Und da in der Barockzeit Inszenierung und Zeremoniell alles waren, musste natürlich schnellstens ein Schloss her, das diesen frisch begründeten Ruhm dokumentierte und zementierte.
Also wurde vor den Toren von Graz schon 1625 der Grundstein für eine nach spanischen Vorbildern erbaute Vierflügelanlage gelegt. Die erblühte über die Jahrzehnte zum prachtvollsten Barockschloss jenseits der Kaiserhöfe zu Wien und Innsbruck. Dabei wurde dieses Schloss Eggenberg nie richtig fertig. Und was darin, eingewoben in geheimnisvolle Symmetrie wie Beziehungsalchemie zwischen 365 Fenstern – 52 davon in der Beletage – und diversen anderen Symbolismen zur Schau gestellt wurde und wird, es war immer nur Lug und Trug. Es erzählte mittels höchster Künstlerfähigkeiten als Märchen aus Backstein, Ziegel, Holz, Gips und Farbe von den Triumphen einer Familie, die es eigentlich nie gegeben hat. Bis heute.
Davon legt, anlässlich der 400. Wiederkehr der Grundsteinlegung, jetzt bis Anfang November eine groß angelegte Ausstellung des hier in Teilen dauerbeheimateten steirischen Landesmuseums Johanneum auf sehr schöne, plastische, intelligente und begeisternde Weise Zeugnis ab. „Ambition und Illusion“ beschreibt klug, auch anrührend die Inszenierung einer Familie durch eine Immobilie, die in selten zeitgenössischer Vollkommenheit bis heute überdauert hat, gerade, weil die Familie so schnell wieder pleiteging.
Die schon 1713 erloschene Linie erlebte ihren historischen und prunkvollen Höhepunkt 1673 mit der in Schloss Eggenberg ausgerichteten zweiten Hochzeit Kaiser Leopolds I. mit Claudia Felicitas von Tirol. Das war die größte Party, die Graz bis zum heutigen Tag erlebt hat. Dafür wurde auch eigens vom Wiener Hofkomponisten Antonio Draghi die beziehungsvolle Ballettoper „Das verwunschene Glück“ verfertigt, die kürzlich als witzige Inszenierung mit Puppen, Sängern und Tänzerinnen bei der 40. Styriarte im Planetensaal des Schlosses wiederbelebt wurde. Dort, wo sich die Eggenbergs in der Mitte ihrer beiden Prunk-Appartements mit je zwölf Räumen als Herrscher sogar des Himmels feiern ließen.
Nun sangen dort Sophie Daneman, Markus Schäfer und Dietrich Henschel, das Ensemble Art House 17 wurde spritzig Michael Hell vom Cembalo geführt. Die beziehungsreich lockere Regie wie Dramaturgie hatte der bewährte Thomas Höft besorgt. Doch auch diese heute so frivol-symbolhafte Oper mit ihren allegorischen Puppen, welche die royale Braut wie Bräutigam (der selbst Musik beigesteuert hatte) verkörperten, sie hatte sich damals einer viel größeren Inszenierung unterzuordnen.
Denn diese sie teuer zu stehen kommende Hochzeit war der glamouröse Gipfel in der Chronik der Familie Eggenberg. Danach ging es, man war hoch verschuldet, schnell bergab. Am Schluss lebte nur noch eine alte Gräfin in der verstaubenden Pracht. Danach wurde das Schloss fast vergessen, ein Glück: Deshalb ist hier immer noch Barock und Rokoko in seltener Pracht und Einheit zu erleben.
Und aktuell wird inmitten der historischen Ausstattung, die souverän die Hauptrolle spielt, von Liebesehen und Zweckheiraten erzählt, von ambitionierten Hofschranzen und unbekannten Helfern, von Glauben und Hoffart, Klimakrise, Krieg und Pestilenz. Filme und Musik sowie sprechende Rauminstallationen machen etwa als Schattenspiele die aufwendige Grand Tour durch Italien zweier junger Eggenberger lebendig, geben Zeugnis von echter Liebe und kalter Berechnung, benutzten Frauen und dienenden Mädchen. Man müht sich, nicht nur die Prunksucht der Fürsten, sondern auch die Ambition der Angestellten zu würdigen, ja sogar die vielen Namenlosen sichtbar zu machen, die für das Funktionieren dieser wahnwitzigen Hofhaltung zuständig waren.
Das gipfelt in der Schlosskirche, in der die aus Böhmisch Krumau, einer weiteren, jüngeren Eggenberg-Residenz, ausgeliehene goldene Zeremonialkutsche ausgestellt ist. Mit der zog 1638 Hans Ulrichs Sohn Johann Anton als kaiserlicher Sonderbotschafter bei Papst Urban VIII. in Rom ein. Fürst Eggenberg hatte die diplomatisch heikle Mission zu erfüllen, die Wahl des Kaisers offiziell verkünden zu lassen. 200 Reitknechte, Gardisten, Musiker, aber auch Edelleute und Pagen in kostbaren Gewändern, begleitet von 60 Reittieren mit goldbestickten Wappendecken marschierten damals durch die Ewige Stadt. Nicht nur in solchen kostbaren Artefakten wird in Eggenberg diese weit entfernte Epoche lebendig – von der als edle Hülle dieses sehr besondere Schloss geblieben ist.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke