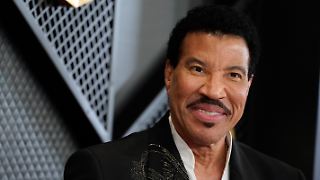Es sind wirklich keine Sensationen versprochen. Keine Lebensdramen, keine vulkanischen Eruptionen künstlerischer Leistungskraft. Keine erkämpften Triumphe, kein tragisches Scheitern, nie ein Skandal. Unendlich ruhig, völlig unspektakulär erzählt die Ausstellung im Frankfurter Städel Museum vom Maler Carl Schuch. Doch selbst wenn einem vor seinen zuweilen bescheiden anmutenden Stillleben und Landschaftsbildern die Augen nicht gleich übergehen, so geht einem doch das Herz auf: angesichts dieses unbeirrbaren Versuchs, wenigstens einmal in der langen Geschichte das Kunstwagnis ganz ohne Aufmerksamkeitsbewirtschaftung eingegangen zu sein.
Solide ausgestattet mit ererbtem Vermögen war der im Jahr 1846 geborene Carl Schuch zu keinem Zeitpunkt an Verkäufen seiner Gemälde interessiert, ist nie bei einem Kunsthändler vorstellig geworden. Und außer Kollegen kannte den Wiener auch kaum einer. Den Schuch-Markt gab es erst auf Betreiben seiner Witwe, die die Bilder nach dem Tod des Malers 1903 dem Berliner Galeristen Haberstock angeboten hat.
Nun spaziert man durchs nachgelassene Werk und wird noch einmal verwunderter Zeuge einer malerischen Kultur, die bei allem Ringen um Gültigkeit völlig frei vom Anspruch auf Geltung geblieben ist. Umgeben von Edelstücken namhafterer Kollegen wie Cézanne, Corot, Monet oder Manet lassen sich Carl Schuchs Stillleben und Landschaften nie auf eine Konkurrenz ein. Vom Zwang zur Überbietung, dem Lebensgesetz der Moderne, hält sich dieses Werk wunderbar frei.
Bei Manet liegt die Melone wie eine Monstranz auf dem altarähnlichen Tisch, kompakt, isoliert, erhaben, ein eigentümliches Ding, oszillierend zwischen Verwunderung und Verehrung. Bei Schuch ist sie aufgebrochen, aufgelöst in ihre farblichen Bestandteile und umgeben von anderen Früchten, die nichts anderes sein wollen als geformtes, gefasstes Kolorit. Nie wird man den Maler dabei ertappen, dass er ein Motiv aus anderem Grund wählt als zur Lösung eines malerischen Problems.
Schon als 19-Jähriger an der Wiener Akademie zog der junge Schuch mit seinem biederen Kunstlehrer Ludwig Halauska in die Umgebung, um „vor der Natur“ zu malen. Ganz nach dem Schulgeschmack der Zeit bringt er blasse Landschaftspanoramen mit, Berge, Seen, Wälder, Himmel, Wolken, wie bei gedimmtem Licht gemalt oder verblichen, als sei die schmale Brille, die der scheue Mann auf der Nase hat, ein wenig naturtrüb geschliffen. Jedenfalls könnte man schwerlich sagen, was er draußen gesucht und gefunden hat. Idyll oder Drama? Weder noch. Keine heroische Landschaft und kein verwunschenes Naturstück und schon gar nicht die Feier unberührter, unversehrter Ursprünglichkeit. Nichts zum Staunen, Verwundern, Sehnen, Preisen.
Carl Schuch: Dramen im Kopf
Dass keine Menschenseele zu entdecken ist, könnte einem ja zu denken geben. Vielleicht meint der Stillstand des Lebensbetriebs Erholung von der wuseligen Stadt. Aber dann entdeckt man, dass das Werk konsequent figurenfrei bleibt. Bis auf ein Selbstbildnis und ein Porträtbild ist die belebte Welt kein Thema. Und die unbelebte scheint voller Dinge, wie von weit hergesehen und ganz ohne Interesse an ihren dinglichen Attraktionen. Es ist aufs Ganze gesehen nicht falsch, wenn man sagt, es liege etwas Weltabständiges über Schuchs Malerei.
Dabei hat er sich ja dauernd umgesehen. Ist rastlos unterwegs gewesen. Hat in Paris gelebt, hat sich in Venedig ein großbürgerliches Atelier eingerichtet. Ist in der Gondel gesessen und auf dem Markusplatz und hat die Stadt mit keinem Strich und keinem Farbtupfer erwähnt. Schuch ist wohl weltweit der einzige Künstler des 19. Jahrhunderts, der sein Italienerlebnis nicht in schwärmerischer Bildausbeute, sondern in Gelassenheit gefeiert hat. Eben, weil er nichts zu erzählen hat, weil ihm Erzählung nichts bedeutet.
„Das Drama in diesem Bild“, hat die Malerin Vroni Schwegler auf Einladung des Städel-Museums kommentiert, „spielt sich in meinem Kopf ab. Es eröffnet Möglichkeiten. Es zeigt mir, dass alles möglich, aber nichts egal ist. Alles, alles hat Konsequenzen, jeder Zug eröffnet neue malerische Probleme und Fragen.“ Das ist ganz dem Maler nachgesprochen. Das ist seine Aufgabe, seine Neugier, sein Thema, dem sich Carl Schuch bis zur Konfession verschrieben hat: malerische Probleme und Fragen.
Wie malt man den silbernen Rand eines Tellers? Wie verträgt sich das Baumgrün mit dem Erdbraun? Bei Cézanne ist jedes Landschaftsbild, jedes Stillleben eine neue Probe aufs Gelingen, auf die Darstellbarkeit der Dinge. Bei Schuch ist jede Landschaft und jedes Früchtestillleben ein neues Ringen mit Farbsteuerung und Lichtführung.
Das ist von großer Faszination, wie der Maler seine Landschaften wie Stillleben anlegt, wie die Malgegenstände da und dort im gleichen diffusen Licht dämmern oder wie sie von hinten von einer verborgenen Lichtquelle aus angestrahlt werden oder wie sich der Wall der Dinge öffnet und eine Lichtung ahnen lässt. Manchmal genügt auch die Rinde einer Birke, um eine jähe Lichtinsel im Dunkel anzuzünden.
Natürlich darf man fragen, ob die Kunst der Schuch-Epoche nicht doch schon ein ganzes Stück weiter war und den Kampf dieses Malers ums wahre Bild nicht längst zu einem Kampf um die Möglichkeit von Bildern überhaupt erweitert hat. Von den Zweifeln und Verzweiflungen eines Paul Cézanne, vom Trotz eines Gustave Courbet, von den scharf konturierten Spiegelungen bürgerlicher Träume eines Édouard Manet oder vom hohepriesterlichen Gestus, mit dem Claude Monet das Großbild dem Kino angenähert hat, von all dem zeigt sich Carl Schuch gänzlich unbeeindruckt. Dass die Kunst an der Schwelle zur Moderne von sich nur noch als existenzieller Notwendigkeit wissen wollte, gehört jedenfalls nicht zu den Selbsterzählungen seiner Bilder.
Ja, das gab’s einmal mitten im Gestürm der Avantgarden, als die Zeitkunst alles auf den Kopf stellen musste: Bilder, denen nicht am Fortschritt gelegen ist. Bilder, die nur am Erscheinen der Dinge interessiert scheinen, an ihrer Bildwerdung, nicht an ihrem Rang oder ihrer Bedeutung. Stillleben wie Landschaften zu malen und Landschaften wie Stillleben, ist für Carl Schuch die denkbar gelassenste Form der Malerei. Und die sture Weiterarbeit an den traditionellen Gattungen beweist nur die stoische Skepsis gegenüber neuen Weltbildern.
Mit Betulichkeit hat diese lässige Reserve aber nichts zu tun! Es ist, wie man sich in der fabelhaften Städel-Ausstellung überzeugen kann, höchst aufregend, wie die Melone in ihre farblichen Bestandteile zerlegt wird, dass man vor lauter pulsierenden Farben ganz vergisst, was da zerlegt wird. Soll man sagen: eine Frühform cooler Abstraktion? Ungegenständliche Malerei avant la lettre? Also doch schon einen Spalt weit die Tür auf zur Moderne? Carl Schuch hätte uns ratlos angeschaut.
„Carl Schuch und Frankreich“, bis 1. Februar 2026, Städel Museum, Frankfurt/Main
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke