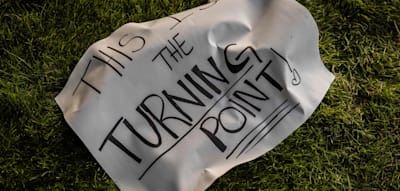Der Kölner Musikwissenschaftler Kai Hinrich Müller bestellt sehr unterschiedliche Forschungsfelder. Er ist die universitäre Kraft hinter gleich zwei Zyklen von Wagners „Ring des Nibelungen“ nach den Erkenntnissen historischer Musizierpraxis, in der Reihe „Musica non grata“ wiederum führte er Musik der im KZ Theresienstadt internierten, aber auch sonst von den Nazis verfolgter Komponisten auf. Und zum vierten Mal gibt es nun, in Zusammenarbeit mit dem Berliner Bauhausarchiv, ein Bauhaus Musik-Weekend in Berlin.
Musik und das Bauhaus? Wie konnte das sein? Zwar hatte Walter Gropius das Bauhaus in Weimar und später Dessau für „Architekten, Bildhauer und Maler“ gegründet, wie er in seinem Manifest schrieb. Doch bald schon kamen Textil- und angewandte Kunst hinzu, und auch das Reich der Klänge sowie das Drama blieben nicht ganz außen vor. Man führte Stücke von Paul Hindemith und Igor Strawinsky in Konzerten auf, Oscar Schlemmer konzipierte bereits zuvor sein „Triadisches Ballett“ mit seinen ikonischen Figurinen von Spirale oder Drahtfigur für eine spätere Aufführung 1923 in Weimar. Man suchte schließlich den ganzheitlichen, den synergetischen Ausdruck als Moment eines neuen Lebensgefühls, das auch die Künste durchdringen sollte.
Kai Hinrich Müller erklärt dieses seit drei Jahren laufende Bauhaus-Projekt so: „Wir schauen, was war eigentlich musikalisch am Bauhaus los. Musik lag dort in der Luft, auch wenn es natürlich keine Musikhochschule war. Wir schauen aber auch, welche Musiker waren durch das Bauhaus affiziert, zum Beispiel George Anteil oder John Cage. Und wir schauen auf die Welt der Oper, denn im Bauhaus gab es ja eine berühmte Bühnenklasse, die bis weit in die Nachkriegszeit hinein das europäische Opernwesen geprägt hat. Und an der Berliner Krolloper waren ebenfalls Bauhäusler wie Oskar Schlemmer und László Moholy-Nagy tätig.“ Am Bauhaus pflegte man, als Kronzeugen einer neuen Sachlichkeit, freilich auch die Musik des gerade wieder in Mode kommenden Johann Sebastian Bach.
„Parabel liebt Kreis“
Im Zuge dieser Recherchen ist Müller jetzt auch auf ein ganz besonderes Stück gestoßen, Marc Blitzsteins Oper „Parabola and Circula“. Blitzstein, amerikanischer Komponist, 1902 in Philadelphia geboren, 1964 auf Martinique gestorben, war auch der Stadt Berlin sehr eng verbunden. Er studierte in der Klasse von Arnold Schönberg, mit dem er gar nicht klarkam, und war in Kontakt mit der sogenannten Avantgarde Novembergruppe, der Antheil, Hanns Eisler, Kurt Weill und Stephan Wolpe angehörten. Und er hatte auch etwas mit dem Bauhaus zu tun. Denn seine Oper sollte, glaubt man zumindest einem Blitzstein-Brief, 1930 gemeinsam mit dem Bauhaus am Theater Dessau aufgeführt werden. Dessen Intendant Hanns Schulz-Dornburg, sei total enthusiasmiert, schrieb er. Es kam nie dazu. Die Noten fanden sich allerdings im Blitzstein-Nachlass.
„Es ist die einzige Oper in der Musikgeschichte, die aus geometrischen Figuren besteht“, ist sich Kai Hinrich Müller sicher. „Die Handlung ist eigentlich eine typische Opernhandlung, wie man sie bei Verdi, Bellini, Puccini finden kann. Es geht um Liebe und am Ende um Tod. Doch hier sind alle Figuren geometrisch. Parabel liebt Kreis. Diese sind die Adoptiveltern von Rechteck und Punkt.“
Doch auch diese Oper geht, wie so oft, nicht gut aus: Aus dem Zweifel Parabolas entsteht ein schwarzes Projektil, welches den Kreis schließlich tötet. Blitzstein stellt ein zerstörtes Paradies dar, mit starken autobiografischen wie zeithistorischen Bezügen: Der Mensch vernichtet, was ihm am nächsten ist. Und wie klingt das? Musik von Marc Blitzstein tönt meist nach Weill, Broadway, Politprotest und Jazz. Diesmal nicht. Er verwendet eine ganz typische Klangsprache der damaligen Zeit. Hindemith trifft auf Strawinsky-Sound. Ein bisschen Jazz ist drin, aber doch auch noch späte Romantik.
Karl-Heinz Steffens, der am 21. September am Pult des Norrköping Symphony Orchestra in der Berliner Philharmonie im Rahmen des Musikfestes im Beisein von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Uraufführung von „Parabola and Circola“ dirigieren wird, erklärt diesen frühen Blitzstein-Klang so: „Da war er total unter dem Spell von Strawinsky, Prokofiew, eben diesen Komponisten, die zur damaligen Zeit schon in Amerika gearbeitet haben. Dann spürt man allerdings zwischendurch schon auch diesen Hang zum Theatralischen, den dann später ja auch Leonard Bernstein in seinen Bühnenwerken übernommen hat.“
Insgesamt umfasst das Werk 21 Nummern mit zehn Szenen bei rund 60 Minuten Musik, inklusive zweier Ballette, von denen eines mit Drahtseilen konzipiert ist, mit denen die Tänzer in einer Gruppe über die Bühne fliegen sollen. Das Libretto gibt Vorschläge für Lichtführung, Bühnenbild und Bewegung, wodurch der Eindruck eines „geometrischen Musiktheaters“ entsteht. Blitzsteins Lehrerin Nadja Boulanger fand „Parabola and Circula“ interessant, angeblich hat sich auch Stardirigent Fritz Reiner die Partitur angeschaut. Blitzstein verwendete später Teile der ungespielten Musik für andere Werke.
„Parabola and Circula“ ist am 25. September bei Deutschlandfunk Kultur nachzuhören. Eine Aufnahme wird später erscheinen.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke