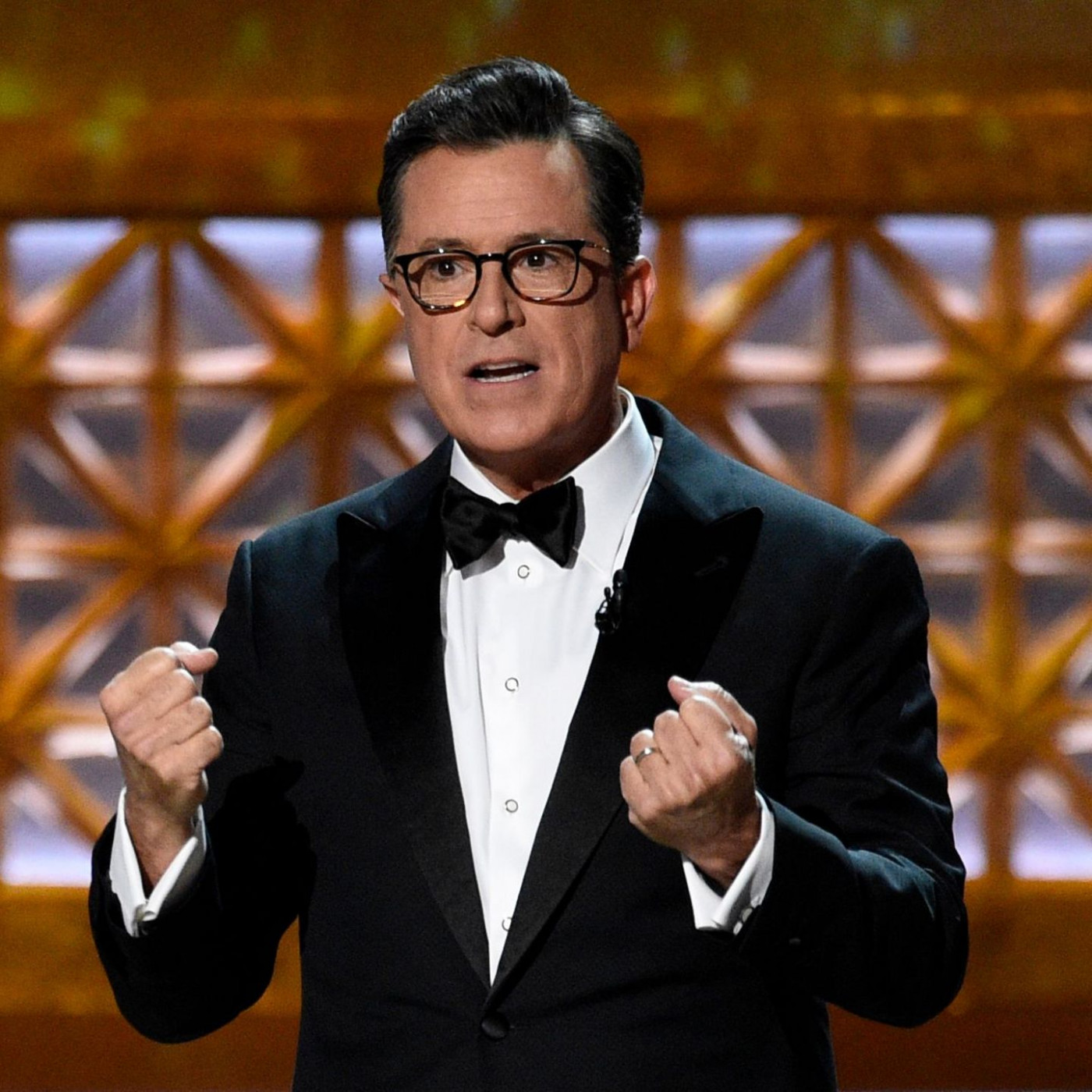Er nennt sich „Fünf-Punkte-Plan gegen den Antisemitismus“. Fünf konkrete Punkte. Ein Plan, also eine Handlungsanleitung. Im Gegensatz zu den zahllosen Lippenbekenntnissen, die nach jeder neuen antisemitischen Attacke in diesem Land abgelegt werden.
Der Plan verlangt verbindliche Bildungsinhalte zu jüdischem Leben. Begegnungsprogramme mit Israel. Dass Aufrufe zur Vernichtung eines Staates eindeutig als Straftat erfasst werden. Veranstaltungen, bei denen Hass gegen Juden propagiert werde, seien konsequent zu untersagen. Öffentliche Gelder dürften nicht an antisemitische Projekte fließen. Die wissenschaftliche Kooperation zwischen Forschungseinrichtungen in Israel und dem deutschsprachigen Raum solle ausgebaut werden.
Initiator des Plans ist Guy Katz, Professor für Internationales Management an der Hochschule München. Verfasser sind Charlotte Knobloch, Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München, Felix Klein, Beauftragter der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland, und Kulturstaatsminister Wolfram Weimer.
200 Erstunterstützer haben den Aufruf unterschrieben, darunter viele deutsch-jüdische Organisationen, Kultureinrichtungen, die Fraktionen von CSU, SPD und Grünen im Bayerischen Landtag, aber auch der FC Bayern München, die Bayerische Amateur Kickbox Union (!) oder die Königlich Bayerische Antifa (!!). Jeder kann die Petition signieren, und jeder kann am 5. Oktober zu der Fünf-Punkte-Kundgebung am Münchner Königsplatz kommen.
Auch an den Kulturbereich wurden Hunderte von Bitten um Unterschrift versandt. 80 Prozent der Angesprochenen antworteten nicht, 20 Prozent lehnten ab. Auf der Liste der Unterstützer stehen nun exakt neun Kulturschaffende: die Literatur-Nobelpreisträgerin Herta Müller, die Schauspielerinnen Uschi Glas, Andrea Sawatzki, Iris Berben, Veronica Ferres und Christian Berkel, der Kabarettist Christian Springer, die Regisseurin Julia von Heinz und der Autor Ferdinand von Schirach (der solche Aufrufe sonst nie unterschreibt). Zum Vergleich: Jüngst forderten 200 Kulturprominente von Daniel Brühl bis Joko Winterscheidt in einem offenen Brief den Stopp deutscher Waffenlieferungen nach Israel.
Die ausführlichste Absage kam von der Deutschen Filmakademie in Berlin. Sie beginnt mit einer Trostformel („Wir finden es großartig, wie sehr Sie sich engagieren“), kommt aber schnell zur Sache: „Mit mehr als 2400 Mitgliedern vereinen wir sehr unterschiedliche Perspektiven, Haltungen und politische Standpunkte unter einem gemeinsamen Dach … Gleichzeitig bedeutet diese Vielfalt, dass wir als Verein in Fragen, die über unsere unmittelbare Arbeit im Film- und Kulturbereich hinausgehen, nicht mit einer einzigen Stimme sprechen können, ohne einzelne Mitglieder auszuschließen oder ihre Positionen unberücksichtigt zu lassen. Vor diesem Hintergrund haben wir uns entschieden, die Erklärung nicht offiziell zu unterzeichnen.“
Kein Freibrief für Netanjahu
Denkt man diese Argumentation genauer durch, hält die Akademie anscheinend Antisemitismus für eine legitime Haltung, der man anhängen könne oder auch nicht; Hauptsache, die Vielfalt bleibt gewahrt. Dasselbe scheint demnach für die Existenz des Staates Israel zu gelten, bei der sich diese deutsche Institution nicht wirklich festlegen möchte, um einige Mitglieder nicht zu verprellen.
Keine einzige Filmhochschule und kein einziger Filmberufsverband haben sich der Initiative angeschlossen, alle tauchen ab. Einer der Verbände beginnt seine Stellungnahme wie die Akademie mit einem Trostpflaster („Natürlich sind wir klar gegen Antisemitismus“), um dann sofort einzuschränken: „In dieser aufgeheizten Zeit ist es jedoch zunehmend schwierig, so undifferenziert Position zu beziehen … Ein Bekenntnis gegen Antisemitismus ist kein Freibrief für die Regierung Netanjahu – so wird es aber zu oft dargestellt und verwendet.“
Nun ist in den fünf Punkten ausdrücklich weder von der Regierung Netanjahu, noch von dem Hamas-Überfall noch von der israelischen Eroberung von Gaza die Rede. Es geht einzig und allein um die alarmierende Zunahme des Antisemitismus in Wort und Tat in Deutschland, der sich in seinem Hass pauschal gegen alles Jüdische in diesem Land richtet.
Zum Abschluss seiner Stellungnahme gelingt der Filmakademie eine erstaunliche rhetorische Kehrtwende. „Auch die arabischstämmige Bevölkerung Gazas und des Westjordanlands, inklusive der arabischen Bewohner Israels, sind per definitionem semitische Völker“, heißt es da. „Der Appell gegen Antisemitismus kann und sollte auch an die Bürger jüdischen Glaubens oder Herkunft weltweit gerichtet werden.“ Was wohl nichts Anderes heißt, als dass die Juden erst einmal bei sich nachsehen sollen, ob sie nicht selbst antisemitisch sind.
Mehr hat die deutsche Filmbranche zu dem Thema offenbar nicht zu sagen, auch die Produzentenschaft nicht. Ein wichtiger Hersteller lehnte es ab, für seine Firma zu unterschreiben, denn: „Was wir zu sagen haben, sagen wir mit unseren Filmen.“ Das wird zu beobachten sein.
P.S.: Und hier noch eine brandaktuelle Zwickmühle für deutsche Institutionen, die in Sachen Israel und Antisemitismus gerne herumeiern. Gestern hat der Kulturminister der Netanjahu-Regierung angekündigt, dem nationalen Filmpreis „Ophir“ die Finanzierung zu entziehen, weil dort der Film „Ha’yam“ (Das Meer) preisgekrönt und für die Oscars nominiert wurde. „Ha’yam“ zeigt die Schikanen, denen ein Palästinenserjunge aus dem Westjordanland ausgesetzt ist, der endlich einmal das Meer sehen möchte. Die Preisverteilung, so der Minister, „spuckt unseren heroischen Soldaten ins Gesicht“.
Frage also an die deutsche Kulturbranche: Müsste man sich für diesen Film einsetzen, weil der Kulturminister ihn nicht mag – oder muss man „Ha’yam“ boykottieren, weil er ein Stück israelische Kultur ist?
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke