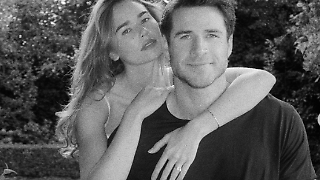Die Ausstellung „Luftbrücke“ in der Galerie Mountains fiel beim Berliner Gallery Weekend im Mai 2025 nicht nur durch ihre künstlerische Tiefe auf, sondern auch durch ihre institutionelle Bedeutung. Mit einem konzentrierten und zugleich umfassenden Blick auf das Werk von David Medalla schloss die Galerie eine auffällige Lücke in der Berliner Kulturlandschaft. Trotz Medallas enger Verbindung zur Stadt – insbesondere durch sein hier beheimatetes Archiv – haben die großen Berliner Museen bislang keine Ausstellung seines Œuvres realisiert, während internationale Häuser diese Aufgabe längst übernommen haben.
Die Galerie vermittelte zudem bedeutende Werke an zwei große Institutionen in Asien, während deutsche Museen weiterhin durch Ignoranz auffallen. Nun zeigt Mountains eine weitere Auswahl von Medallas Arbeiten in den Wilhelmhallen in Berlin-Reinickendorf – einem beeindruckend sanierten Industriebau, in dem mehrere Galerien, Privatsammlungen und Kunstinitiativen ihre Beiträge auf dem Kunstfestival „Hallen 06“ (bis 14. September 2025) zur Berlin Art Week 2025 präsentieren.
Als Pionier partizipativer und kinetischer Kunst hinterließ David Medalla, der 2020 verstarb, ein Werk, das ebenso wandelbar wie anziehend ist. Der Strom aus Gesten und Materialien, den er schuf, ebnete zwar nachfolgenden Generationen den Weg, machte ihn selbst jedoch zu einem „Künstler für Künstler“ – einem weithin unterschätzten Außenseiter. Doch heute wächst seine Relevanz in der zeitgenössischen Kunstwelt: Kuratoren entdecken sein radikales Erbe neu – in einer Zeit, die nach Modellen kreativer Neuerfindung und nach Widerstand gegen den alles verschlingenden Kunstmarkt sucht.
Formale Bildung und radikale Freiheit
1942 in Manila geboren, zeigte Medalla schon früh außergewöhnliche Fähigkeiten. Er hatte eine Leidenschaft für Literatur und veröffentlichte bereits mit zwölf Jahren Gedichte in philippinischen Zeitschriften (in späteren Gemälden porträtierte er literarische Figuren, die ihn prägten). Ein Stipendium brachte ihn an die Columbia University in New York, wo er Philosophie und Philologie studierte. Doch bald wurde er des akademischen Rahmens überdrüssig – ein Spannungsverhältnis zwischen formaler Bildung und radikaler Freiheit, das sein gesamtes Leben und Werk prägen sollte.
In den 1960er-Jahren zog Medalla nach London, wo seine Anwesenheit die Avantgarde elektrisierte. Gemeinsam mit Gustav Metzger, Marcello Salvadori, Guy Brett und Paul Keeler gründete er die legendäre Signals Gallery – ein Schmelztiegel experimenteller Kunst, in dem sich Wissenschaft, Politik und Ästhetik verbanden. Das Programm war visionär: Heinz Mack, Lygia Clark, Jesús Rafael Soto, Mira Schendel und Takis gehörten dazu.
Doch Medalla war nicht bloß Initiator – er war Dreh- und Angelpunkt. Besonders seine heute ikonischen „Cloud Canyons“ verkörpern das Prinzip unaufhörlicher Verwandlung. Diese „auto-kreativen Skulpturen“ – eigentlich Schaum erzeugende Maschinen aus Plexiglasröhren und Schläuchen – atmen vergängliche Seifenblasengebilde aus, die aufsteigen und sich auflösen. Niemals gleich, niemals wiederholbar.
Eine dieser Skulpturen war kürzlich in der Berliner Julia Stoschek Foundation in einer Gruppenausstellung zu sehen; eine andere wurde 2006 von der Tate Gallery in London erworben. Einige dieser „Wolkenskulpturen“ sowie poetisch-humorvolle Sandarbeiten stehen nun im Mittelpunkt der Präsentation der Mountains Gallery beim Hallen-Festival in den Berliner Wilhelmhallen.
David Medallas Werk „A Stitch in Time“ ist eine stille Revolution partizipativer Kunst. Das seit 1968 fortlaufende Werk besteht aus einem großformatigen, aufgehängten Tuch, begleitet von Nähutensilien. Die Besucher werden dazu eingeladen, persönliche Gegenstände – von Botschaften und Namen bis hin zu Andenken – direkt auf den Stoff zu sticken, zu nähen oder anzubringen. Das Werk entwickelt sich ständig weiter und wird jedes Mal, wenn es gezeigt wird, vom Publikum neu geschaffen.
Sein scheinbar einfacher Akt schuf einen demokratischen Raum, in dem sich politisches, persönliches und poetisches Denken verflechten konnten – eine Einladung zur kollektiven Autorschaft. Das Werk aus dem Jahre 1981, das die Galerie zur Gallery Weekend präsentierte, wurde bei einem Event in Berlin geschaffen und lies einen historischen Moment wieder aufleben, in dem solche Formen der Teilhabe noch als radikal galten.
In einer Gegenwart, in der Interaktivität oft zur bloßen Geste auf überladenen Biennalen verkommt, erinnert „A Stitch in Time“ an die ursprüngliche Kraft prozessorientierter Kunst. Medallas Teilnahme an Harald Szeemanns Ausstellung „When Attitudes Become Form“ (1969) und der Documenta 5 (1972) – insbesondere mit dem kollektiven „People’s Participation Pavilion“ – belegen seine zentrale Rolle bei der Neudefinition nicht nur der Form, sondern auch der Funktion von Kunst: Bedeutung entsteht nicht mehr im Objekt allein, sondern in der Erfahrung – und nicht im einsamen Künstler, sondern im kollektiven Subjekt.
Dieses Ethos nahm Medalla mit nach Berlin, wo er 1997/98 mit einem DAAD-Stipendium lebte. Die fragmentierte, sich ständig wandelnde Kulturlandschaft der Stadt bot seiner ruhelosen Vorstellungskraft ein ideales Umfeld. Er wurde rasch Teil der experimentellen Kunstszene, inszenierte Performances im öffentlichen Raum, die zwischen poetischer Geste und politischer Aussage changierten.
Medallas „Wiederentdeckung“
Zum Berlin Gallery Weekend waren Gemälde aus dieser Zeit zu sehen, darunter ein Porträt von Maria Gräfin von Maltzan, die zur NS-Zeit vielen Juden das Leben rettete. Medalla begegnete ihr im queeren Wohnprojekt Tuntenhaus. Seine Hommage – intim, frech, aufgeladen mit Symbolen aus seiner persönlichen Ikonografie, wie einem tanzenden Affen – verbindet Humor und Subversion mit Erinnerungsarbeit. Diese Verbindung aus Verspieltheit und Ernsthaftigkeit durchzieht sein gesamtes visuelles Werk, insbesondere seine Malerei, in der Sinnlichkeit, exotische Bildsprache und historische Reflexion oft verschmelzen.
Während die Kunstwelt weiterhin ihre Kanons hinterfragt und über Inklusion diskutiert, stehen Medallas Leben und Werk als leuchtender Beweis dafür, dass die radikalsten künstlerischen Praktiken oft am Rand entstehen. Sein Erbe war nie verborgen, sondern immer da – versammelnd, aufsteigend, sich auflösend, wiederkehrend – wie der Schaum in den „Cloud Canyons“. Und doch wurde er „entdeckt“: 2017 war Medalla mit „A Stitch in Time“ auf der Biennale von Venedig vertreten. Doch da hatte ihn ein Schlaganfall bereits weitgehend gelähmt. Im überladenen Kontext partizipativer Praktiken jener Biennale trat der Pioniergeist seines visionären Werks zudem in den Hintergrund.
Die Ausstellung „David Medalla: Parables of Friendship“ im Bonner Kunstverein (2021) und im Museion Bozen (2022) war ein Meilenstein: kinetische Skulpturen, Zeichnungen und Archivmaterial wurden erstmals zusammengeführt. Eine weitere Einzelausstellung eröffnete 2024 in Los Angeles.
Medallas Weigerung, sich durch Geografie, Medium oder Ideologie einordnen zu lassen, wirkt heute geradezu visionär. Lange, bevor das Modell des „netzwerkenden Künstlers“ zum Standard wurde, verkörperte Medalla es – als Ermöglicher, Provokateur, niemals aber als Egoist. Seine Kunst war leise radikal – getragen von Freude, Intimität und geteilten Erfahrungen. Ob durch eingenähte Botschaften, aufsteigenden Schaum oder Seifenblasen – er schuf Räume der Verbindung und des Staunens. Bei aller intellektueller Tiefe blieb sein Werk zutiefst menschlich – wie eine Probe für eine offenere, großzügigere (Kunst-)Welt.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke