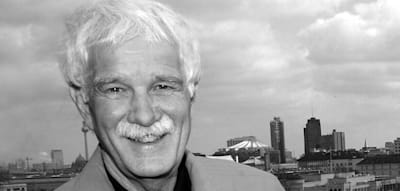Als der Autor beim Schlussapplaus auf der abschüssigen Bühne kurz den Halt zu verlieren droht, geht ein Raunen durchs Publikum. Kurz darauf hat Ferdinand Schmalz, wie stets im dunklen Anzug und mit Hut, die Balance wiedergefunden. Man fragt sich nur, ob das auch für sein neuestes Stück „Bumm Tschak oder Der letzte Henker“ gilt, das eigentümlich unausgewogen, wie leicht weggerutscht wirkt. Schmalz erzählt ein Schauermärchen von der Machtergreifung einer Kanzlerin, die die Todesstrafe wieder einführt und am Ende selbst unter dem Beil landet. Was ein drastisches Lehrstück über die Gefahren einer rechtspopulistischen Regierung sein will, kommt nicht wirklich in Tritt.
Bei den Bregenzer Festspielen uraufgeführt, hat „Bumm Tschak oder Der letzte Henker“ nun die Spielzeit des Wiener Burgtheaters eröffnet. Regie hat der Burgherr, Intendant Stefan Bachmann, höchstselbst geführt, der sein achtköpfiges Ensemble von allen Versuchungen eines Schauspiels fernhält, das Figuren mit inneren Regungen auf die Bühne bringt. Stattdessen sieht man ein Tableau schriller Märchenfiguren: So tritt beispielsweise die Kanzlerin als böse Fee im Glitzerkostüm auf (Melanie Kretschmann), die zwei fabelhafte Horrorclowns (Sarah Viktoria Frick und Mehmet Ateşçi) als Schergen mitschleppt. Die dürfen sogar, statt nur Text aufzusagen, minimal miteinander spielen.
Wer sich bewegt, ist auf der Bühnenschräge von Olaf Altmann klar im Nachteil, in deren Mitte sich ein Fallbeil wie bei einer Riesenguillotine immer wieder bedrohlich hebt und senkt – und so den Abend in einzelne Szenen zerhackt. Die spielen vor allem in einem Club mit dem halsabschneiderischen Namen „Schafott“, dessen Tür härter sein will als die aller Berliner Szeneclubs zusammen. Chef des Ladens ist ein gewisser Josef (Max Simonischek), dem sein Gspusi auf den Rücken springt. Das Aktivisti mit der pinken Perücke (Maresi Riegner) wird tatsächlich zu einer nicht geringen Belastung, weil es die neue GröKaZ mit Farbe überschüttet hat und deswegen schon bald im Knast landet.
Wie im Märchen muss der Prinz nun seine Geliebte aus dem Gefängnis befreien, nur hat sich die böse Fee etwas besonders Fieses überlegt: Josef, in Begleitung einer völlig rätselhaften Figur namens Flamboyanza (Thiemo Strutzenberger) unterwegs, soll dafür nämlich einen anderen Gefangenen (großartig lakonisch: Stefan Wieland) hinrichten. Gesagt, getan. Das erweist sich zudem als wirksame Werbemaßnahme für den Club, weil das Kopfabhauen die Leute extrem begeistert. Am Ende wird einem als Zuschauer nahegelegt, das Geschehen als Symptom einer insgesamt kopflosen Epoche zu deuten. Was noch schöner wäre, wenn man mehr über die Ursachen dessen erfahren würde.
Einerseits sieht „Bumm Tschak oder Der letzte Henker“ aus wie ein düsteres Disney-Märchen, auch wegen der knalligen Kostüme von Adriana Braga Peretzki. Andererseits will der Abend aber auch als Politparabel ernst genommen werden (vermutet man nicht zuletzt wegen der Interviews vorab von Schmalz). Und mit diesem Genrecocktail gerät der Abend doch arg aus der Balance und ins Stolpern, weil er weder die schauerliche Gesellschaftsgroteske ist, die durch Übertreibung die Wirklichkeit entschleiert, noch das raffinierte Politlehrstück, das gnadenlos das Räderwerk der Macht bloßlegt. Und die Ansätze, die davon vorhanden sind, fügen sich nicht zu einem überzeugenden Ganzen.
Selbst als der letzte Kopf gefallen ist, wird einem nicht ganz klar, welcher Konflikt in dem Stück ausgetragen wird, der sich nicht einfach dadurch lösen ließe, dass die fiese Fee guillotiniert wird. Da diese bereits mit ihrem ersten Auftritt als superböse eingeführt wird, braucht es eigentlich nicht knapp zwei Stunden, bis einem das einfällt. Umwege können zwar das Schönste beim Erzählen sein, sind es nur eben nicht zwangsläufig. Sprachlich ist das Stück zwar kunstvoll, zieht einen jedoch auch nicht in den Bann. Und die hochkarätig besetzte Uraufführungsinszenierung langweilt zwar nicht, entwickelt jedoch kaum jene Dringlichkeit, die hier vom gewählten Stoff eigentlich geboten wäre.
Weit bissiger ist der zweite Eröffnungsabend am Burgtheater, der von den Salzburger Festspielen nach Wien kommt und trotz des über 100 Jahre alten Textes aktueller wirkt als die ambitionierte Gegenwartsdramatik: „Die letzten Tage der Menschheit“ von Karl Kraus. Aus dem laut Autor unaufführbaren Monumentalwerk hat Regisseur Dušan David Pařízek mit seinem siebenköpfigen Ensemble einen auf wenige Szenen und Figuren reduzierten Abend gemacht. Die schlichte Holzkonstruktion auf der Bühne verweigert sich jedem Spektakel, sondern erfordert, sich auf die Worte zu konzentrieren und genau hinzuhören: auf die Verunstaltungen der Sprache und den Horror des Unaufrichtigen.
Obwohl der Abend in Salzburg gemischte Reaktionen hervorrief, ist es vorstellbar, dass er sich in Wien zum Dauerrenner entwickelt. Das liegt an den großartigen Schauspielern, vor allem aber am Text. Meisterhaft und rücksichtslos spielt Kraus der Gesellschaft ihre eigene Melodie vor. Und nicht zufällig gerät bereits die mediale Dauerbeschallung in sein Schussfeld, die nach vorgefertigten Mustern betriebene Meinungsmache der Presse wird sein liebster Feind. Dass sich Kraus allein mit der Autorität seines Wortes gegen die kriegstreiberischen Mehrheitsmeinungen seiner Zeit behauptet hat, beeindruckt bis heute. Etwas mehr Kraus wagen ist jedenfalls stets ein guter Rat für das Theater.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke