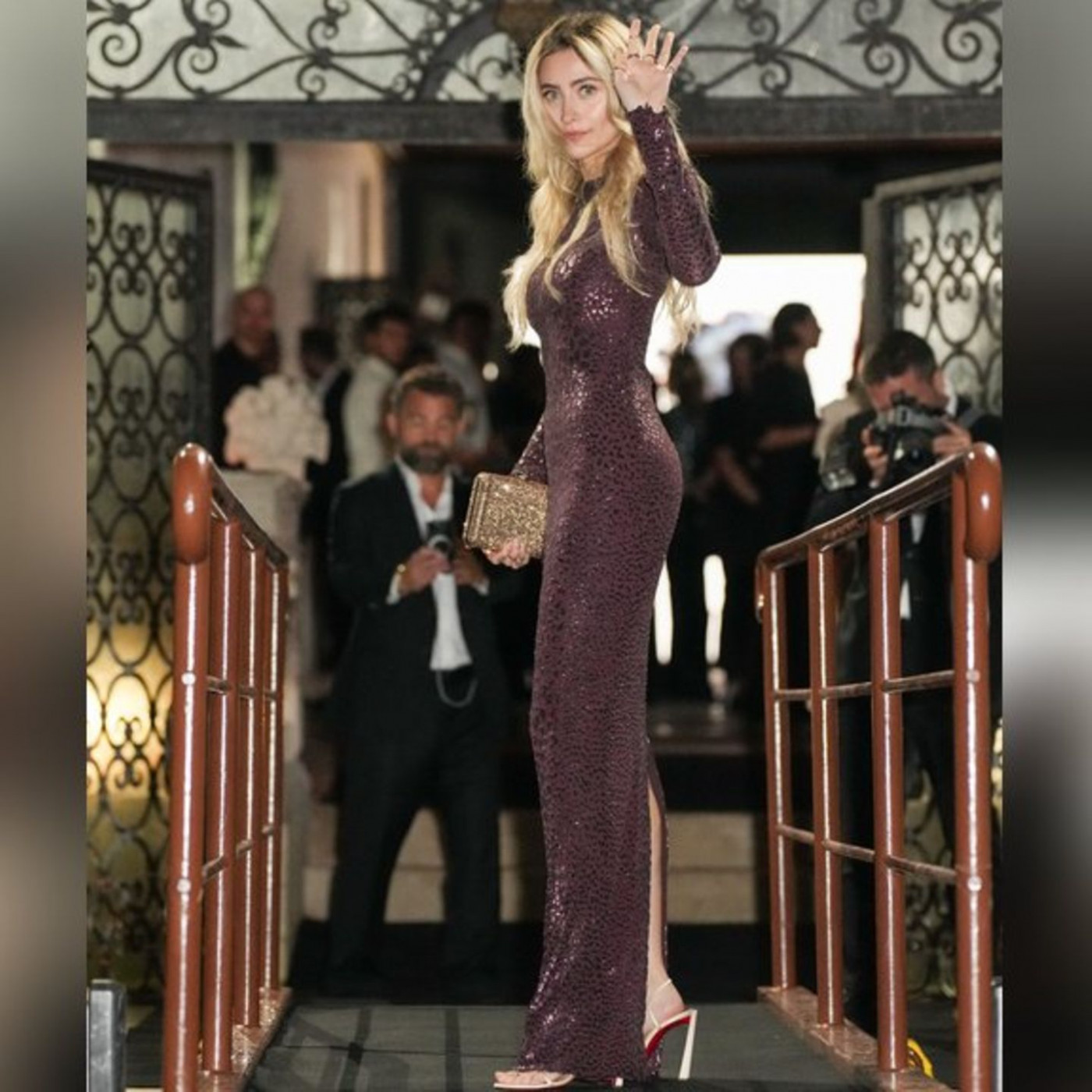Bahn-Wahnsinn, Körperschmuck, Aufrüstung und Nahost-Konflikt: Kaum ein Thema, das Til Mette nicht zeichnerisch kommentiert. Ihn interessiert weniger die große Politik als vielmehr deren Auswirkungen auf den Alltag, "von totaler Albernheit bis zur schärfsten Gesellschaftskritik", wie er im Interview mit ntv.de sagt. Mette, der zu den bekanntesten Cartoonisten des Landes gehört, hat gerade ein neues Buch herausgebracht. Nun erzählt er von seiner Motivation, spricht über seine Zeit in den USA - und über alte weiße Männer.
ntv.de: Herr Mette, wie oft könnten Sie selbst der Protagonist Ihrer Zeichnungen sein?
Til Mette: Das bin ich sehr oft, auch in peinlichen Situationen. Ich zeichne viele Szenen, die mein eigenes Befinden aufgreifen. Ich nehme mir dann die Freiheit, mich als Frau zu zeichnen oder als Kind - egal, wie die gezeichnete Figur aussieht, die Szene kommt oft aus einer Situation, die ich selbst erlebt habe oder die meiner Denke entspricht. So kann ich auch unverschämte Sachen darstellen, die man sich in der Realität eigentlich gar nicht traut. Das ist ein gutes Ventil.
In Ihren Zeichnungen geht es zwar auch um Politiker, aber meist stehen "normale" Menschen im Mittelpunkt, die mit politischen und gesellschaftlichen Debatten konfrontiert werden. War das von Anfang an Ihr Anliegen?
Das ist gewachsen. In den 80er Jahren habe ich noch klassische tagespolitische Karikaturen gemacht. Aber ich bin davon abgekommen. Manche Politiker haben es als Auszeichnung gesehen, gezeichnet zu werden, selbst wenn es eine Schmäh-Karikatur war. Sie wollten sogar die Originalkarikatur haben. Aber ich bin kein Hofmaler. Ich zeichne nicht, damit dann ein Staatssekretär anruft, um seinem Dienstherrn die Zeichnung zu besorgen.
In Interviews erwähnen Sie immer wieder, dass Sie in der Tradition des Magazins "New Yorker" stehen.
Ich hatte immer amerikanische Zeichner als Vorbild. In den USA gibt es ein Genre, für das es in Deutschland keinen richtigen Namen gibt: der "social cartoon", der sich um gesellschaftliche Themen dreht. Der hat ein größeres Themenspektrum, das von totaler Albernheit bis zur schärfsten Gesellschaftskritik reicht. Das kommt meinem Naturell entgegen.
Im Buch stehen entsprechend Kalauer neben Cartoons über Gaza.
Und beides will ich auch weitermachen. Gaza, Israel, Antisemitismus - das sind große Themen, die mich sehr bewegen, vor allem die Schrulligkeit, mit der wir damit umgehen. Wie wir um Standpunkte ringen und falsch verstanden werden - das ist eine Steilvorlage für Zeichnungen. Das will ich in meiner Arbeit nicht auslassen.
Der Versuch, nicht in Fettnäpfchen zu treten, ist in Deutschland sehr ausgeprägt.
Jeder ist immer schnell beleidigt und die Empfindlichkeit hat leider zugenommen. Aber ich bin dem "Stern" sehr dankbar, weil sie mir relativ viel Freiraum lassen. Ich denke, das liegt daran, dass der "Stern" seit 75 Jahren Zeichnungen veröffentlicht und seine Leserschaft dazu erzogen hat, wie man mit Satire umgeht.
Seit knapp 30 Jahren zeichnen Sie für den "Stern". Schauen Sie sich manchmal noch frühere Cartoons an?
Nein.
Wissen Sie noch, mit welchem Cartoon Sie sich damals beworben haben?
Ja, klar, das vergisst man nicht. Ich habe mich damals bei Chefredakteur Werner Funk beworben, vor dem viele Leute gezittert hatten. Zu dieser Zeit, 1995, kam der Wonderbra auf, dieser BH mit besonderer Stützfunktion. Also habe ich eine Männer-Unterhose mit Stützfunktion gezeichnet. Funk fand das so lustig, dass er mich eingestellt hat.
War das für Sie ein wichtiger Karriereschritt?
Aber hallo! Wenn man 1995 Zeichner beim "Stern" wird - das war der Himmel.
In einem Cartoon im Buch fällt der schöne Satz: "Ich kann zwar nicht die Welt verändern, aber unser Wohnzimmer."
Da haben wir gerade ein Zimmer renoviert. Da ich noch etwas zeichnen musste, habe ich einfach mich selbst genommen.
Glauben Sie, dass Cartoons etwas bewirken können?
Sehr lange habe ich das geglaubt, und das war auch gut so, sonst würde man das nicht durchhalten. Aber mit der Zeit bemerkt man, wie wenig man bewirkt. Trotzdem gibt es eine Legitimation: Ich will Freunde und Leute, die so ticken wie ich, unterhalten - damit sie weiter für irgendeine gute Sache kämpfen, zum Beispiel gegen den Rechtsdrall, gegen den ganzen Bullshit, der uns umgibt. Diese gute Stimmung finde ich hilfreich.
Ihre Zeichnungen wirken aber nie moralisierend.
Ja, weil mich das selber ankotzt. Meine Mutter war Musik- und Theaterlehrerin und hat Stücke von Bertolt Brecht aufgeführt. Als Kinder mussten wir uns die anschauen. Dieses Zeigefingertheater, das die Welt in Gut und Böse einteilt, hat mich zutiefst abgeschreckt. So ist die Welt nicht, es gibt immer Grautöne.
Trump kommt in Ihrem Buch auch vor. Sie haben von 1992 bis 2006 in den USA gelebt, sind sogar Staatsbürger geworden. Treibt es Sie jetzt um, was dort passiert?
Ja. Als wir Anfang der 90er Jahre nach New York gingen, erlebte die Stadt einen kulturellen, gesellschaftlichen und ökonomischen Boom. Alles wurde positiver, bis die Anschläge vom 11. September 2001 dem einen brutalen Schlusspunkt gesetzt haben. Heute merke ich, in was für einer demokratischen Blase wir damals gelebt haben. Denn in den 90er Jahren konnte man den Aufstieg der ultrarechten Tea-Party-Bewegung oder der Evangelikalen schon sehen. Wir haben das nur nicht ernst genommen, weil das für uns Hillbillys in Alaska oder West Virginia waren. Das war eine unglaubliche Sünde.
Wiederholt sich das in Deutschland?
Es gibt Parallelen. Wir sehen Strömungen zum Beispiel in den ostdeutschen Bundesländern, innerhalb der konservativen Rechten, die wir nicht ernst genommen haben. Mit einer ziemlichen Arroganz haben wir jeden Dialog abgelehnt, weil wir uns in unserer Blase sicher gefühlt haben. Jetzt passiert etwas Ähnliches wie in den USA. Ich hoffe nur, nicht mit diesen drastischen Konsequenzen.
Im Buch gibt es diese schöne Karikatur, in der ein General in der Tür steht und sagt: "Guten Tag, ich bin Ihre neue Meinung."
Ich habe mich dabei gefragt, warum manche Menschen auf einmal so explizit ihre Abneigung oder Zuneigung zu irgendetwas äußern. Meiner Meinung nach wurde das von außen reingetragen. Ich glaube nicht, dass alle innerlich diese Wut haben. Ich merke aber auch selbst, dass ich ein bisschen konservativer geworden bin. Das ist eigentlich eine Banalität und nichts Neues in meiner Altersgruppe, aber trotzdem erschreckend, wenn man sich dabei ertappt.
Der berühmte alte weiße Mann?
Ich habe eine Art Herzenswärme zum alten weißen Mann entwickelt, oder zum Boomer. Ich entwickle mütterliche Instinkte, wenn ich das höre, weil dieser Begriff sehr schräg ist. Aber das ist ein großartiges Thema, das ich gern behandle.
Wie sieht es denn aus mit dem Cartoonisten-Nachwuchs in Deutschland?
Es gibt viele Nachwuchs-Zeichner und -Zeichnerinnen. Als ich anfing, gab es da kaum Frauen. In dieser Hinsicht ist die Entwicklung sehr positiv, weil dadurch auch das Themenspektrum erweitert wurde. Gleichzeitig gibt es sehr wenige Zeichnerinnen und Zeichner mit migrantischem Hintergrund. Wir sind immer noch sehr biodeutsch.
Sie arbeiten für ein Printmedium. Wie sehen Sie da die Zukunft für Cartoons?
Der Bedeutungsverlust der Printmedien ist für den Beruf des Zeichners dramatisch und eine absolute Gefahr. Heute kann kaum noch ein junger Zeichner oder eine junge Zeichnerin davon leben. Sie alle müssen etwas anderes nebenher machen, das Zeichnen wird zum Hobby. Damit geht auch eine gewisse Ernsthaftigkeit verloren. Und im Internet haben wir es nicht geschafft, eine Bezahlkultur zu etablieren, um journalistische Produkte wie die Karikatur zu honorieren. Das führt meiner Ansicht nach zur Verabschiedung bestimmter Berufsgruppen aus dem freien Journalismus.
Ist Künstliche Intelligenz für Sie eine Konkurrenz?
Noch nicht, Illustratoren sind da im Augenblick deutlich bedrohter. Aber für die breite Öffentlichkeit ist KI ja erst seit etwa zweieinhalb Jahren zugänglich und die exponentielle Entwicklung in dieser Zeit ist dramatisch. Ich könnte nicht sagen, ob nicht in einem halben Jahr jede Karikatur in jeder Couleur von KI erstellt werden könnte. KI wird das irgendwann können. Das betrifft aber jeden Beruf.
Im kommenden Jahr werden Sie 70. denken Sie manchmal daran, das Zeichnen an den Nagel zu hängen?
Rechts und links in meinem Umfeld gehen alle in Rente oder sie sind gerade dabei. In meinem Alter ist das natürlich ein Thema. Als ich Ende 30 war, habe ich auf die Arbeit eines 60-Jährigen geschaut und dachte: Er hat doch alles erzählt, da kommt nichts Neues mehr. Auch bei mir wird kein völlig neuer Denkansatz mehr kommen. Ich selber schaue da milde drauf. Für einen 30-Jährigen bin ich aber einer dieser alten Säcke, die alles erzählt haben. Deswegen weiß ich auch, dass es einen guten Grund gibt, irgendwann aufzuhören. Wie ich dann damit umgehe, weiß ich aber nicht.
Mit Til Mette sprach Markus Lippold
Karikaturen von Til Mette erscheinen wöchentlich im "Stern". Auf stern.de gibt es zudem ein Archiv mit alten und neuen Zeichnungen.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke