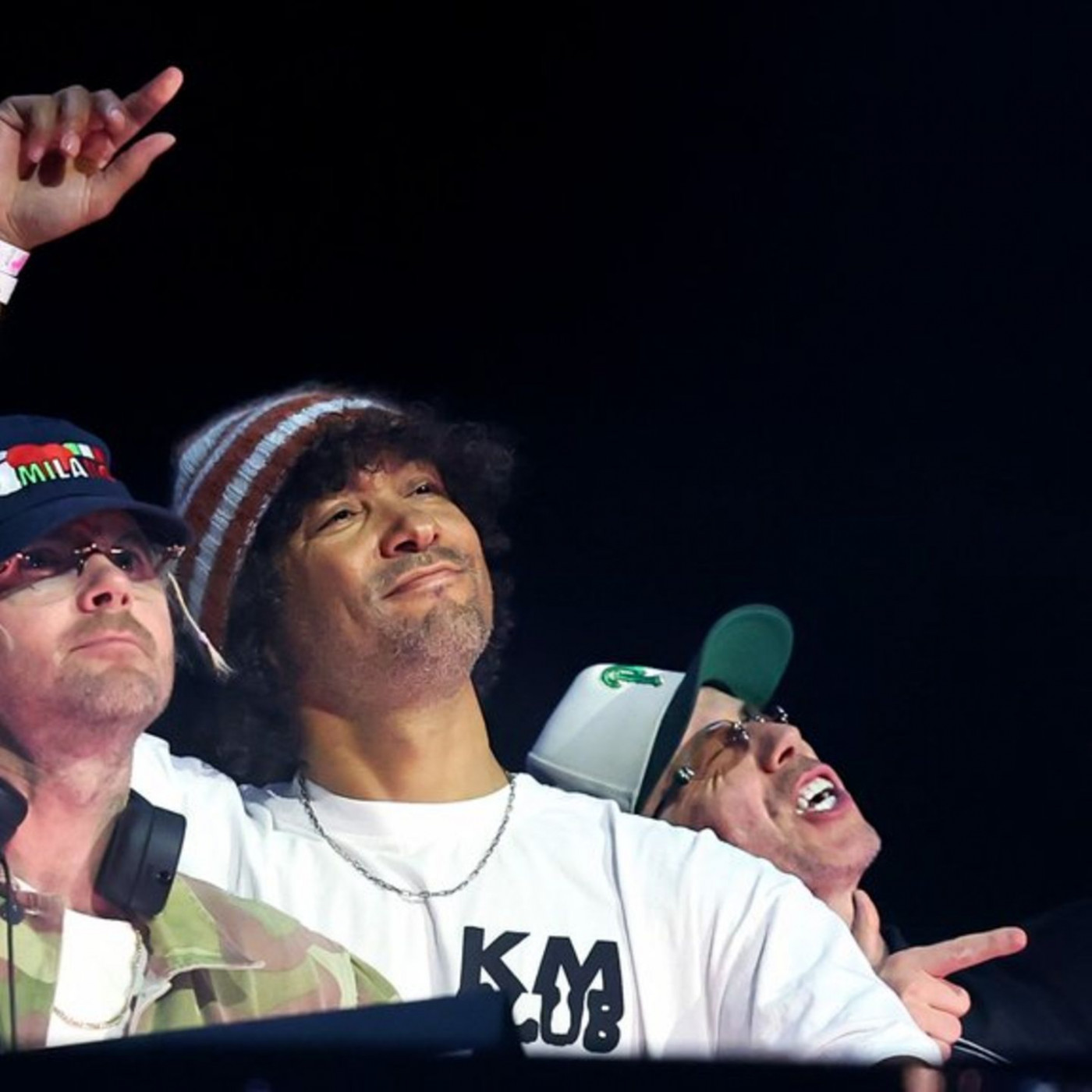Er war ein Jahrhundertdichter – und ein frühes Opfer jener Epoche, die wir heute als „Cancel Culture“ kennen. Ein Zeitalter, in dessen Gegenwart wir ständig weiter hineinschlittern, weil wir dem Alarm über alles und jedes so viel Raum geben und ihm damit nachgeben. Böse Bücher in Bibliotheken, Ismen in der Haltung oder vermeintlich problematische Begriffe in der Alltagssprache und sogar in der Dichtung beschäftigen uns heute über Gebühr. Ein Paradebeispiel dieser Killerdynamik war der Umgang mit Eugen Gomringers Gedicht „avenidas“.
Ein zauberhaftes Gedicht, nicht zufällig auf Spanisch verfasst, denn Eugen Gomringer kam am 20. Januar 1925 als Sohn einer Bolivianerin und eines Schweizer Geschäftsmannes in Cachuela Esperanza zur Welt; sein Geburtsort ist ein Dorf im bolivianischen Urwald, an einem Quellfluss des Amazonas gelegen. Gomringer wuchs dann bei den Großeltern in Zürich auf, studierte Nationalökonomie und Kunstgeschichte, machte ein Volontariat bei einer Zeitung – und begann zu dichten.
„avenidas“, inspiriert durch die Promenade Las Ramblas in Barcelona, entstand 1951 und handelte von Straßen, Blumen, Frauen und einem männlichen Bewunderer. avenidas, flores, mujeres – y un admirador. So schön, so spielerisch, dass irgendjemand fand, das könne doch auch das ruppige Berlin inspirieren. Zum Beispiel an der Fassade der Alice-Salomon-Hochschule, wo es seit 2011 eine Hauswand zierte.
Doch was machten Berliner Studierende 2018 daraus? Sie fanden, die Perspektive dieses Gedichts sei sexistisch. Sie setzten ihre aktivistische Lesart als absolut und lancierten mit Erfolg eine Initiative, um das Avenidas-Arrangement der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin zu entfernen, wo es als Kunst am Bau auf die Hauswand gepinselt war. Der Fall löste eine bundesweite Debatte über den Status der Kunstfreiheit in Deutschland aus und die Borniertheit von Studenten, die gar nicht wussten, welchen Meister der Sprache sie aus ihrem Sichtfeld verbannten. „Kommandier(t) die Poesie“ heißt die Autobiografie von Eugen Gomringer. Dieses Motto hatte der akademische Nachwuchs ohne jeden Sinn für Spielerei zu wörtlich genommen. Immerhin fand das Gedicht „avenidas“, das in vielen Anthologien abgedruckt ist, als Kunst im öffentlichen Raum bald Asyl an einer Hausfassade in Gomringers fränkischer Wahlheimat Rehau.
Konkrete Poesie und ihr Prinzip
Was machte Gomringers Dichtung so besonders? Er befreite die Lyrik von klassichen Versen und machte „konstellationen“ daraus. Weg mit allen Schnörkeln, Spielereien und Regeln (wie Großschreibung, Interpunktion oder gar Ballast wie Gefühlen und Reim. „konkrete poesie - poesia concreta“ hieß eine von Gomringer herausgegebene Schriftenreihe, die zum Programm und Markenzeichen wurde. Seine Gedichte wurden zum Sinnbild einer radikalen Entschlackung, zum Ulmer Hocker der Lyrik: scheinbar simple Massenware, doch formschönes Originalhandwerk.
Nicht zufällig stand Gomringer auf Tuchfühlung zur Welt der Designs, Er war Sekretär von Max Bill, dem Erfinder der Konkreten Kunst und Rektor der legendären Ulmer Hochschule für Gestaltung, später wirkte er als Geschäftsführer des Schweizerischen Werkbundes, Kulturbeauftragter der Porzellanfabrik Rosenthal im oberfränkischen Selb und Professor für Theorie der Ästhetik an der Kunstakademie Düsseldorf.
Soviel also zur Frage, ob man von Lyrik leben kann. Nein, aber man kann mit ihr das Leben anderer Menschen inspirieren. Man kann halbstarke Schüler staunen machen, was Sprache überhaupt ist und kann, wenn man so mit ihr spielt:
kein fehler im system
kein fehler imt sysem
kein fehler itm sysem
kein fehler tmi sysem
kein fehler tim sysem
kein fehler mti sysem
kein fehler mit sysem
Mit solchen und ähnlichen Gedichten ging Eugen Gomringers konkrete Poesie in den Kanon ein. Was für eine Jahrhundertfigur dieser Dichter war, wird auch deutlich, wie viele Kollegen aus benachbarten Jahrgängen er überlebte: Ernst Jandl (geboren 1925), Siegfried Lenz (1926), Ingeborg Bachmann (1927), Martin Walser (1927), Günter Grass (1927), Günter Kunert (1929), Peter Rühmkorf (1929), Hans Magnus Enzensberger (1929) – allesamt auch Lyriker, aber selten so genial wie Gomringer.
2019 hatte der bolivianich-schweizerische Franke seinen Nachlass zu Lebzeiten („Vorlass“) ins Schweizerische Literaturarchiv (SLA) nach Bern gegeben. Dort warten 400 Schachteln Archivmaterial auf ihre Erforschung durch künftige Generationen. Künftig werden Menschen sein Gedicht „avenidas“ als Mahnung dafür lesen können, was Kunst passiert, wenn sie in die Fänge von unmündigen Banausen und haltungsbesorgten Aktivisten gerät, denen ihre für absolut gesetzte Lesart wichtiger ist als das „offene Kunstwerk“.
Im Januar konnte Eugen Gomringer noch seinen 100. Geburtstag feiern. Nun ist er in Bamberg gestorben. Er hinterlässt eine bekannte Tochter, Nora Gomringer, die ihrerseits einen Weg als geachtete Lyrikerin und hochrührige Managerin des Künstlerhauses Villa Concordia in Bamberg beschritten hat.
Möge der tosende Verkehr auf den Avenidas dieser Welt für einen Moment innehalten, pausieren, schweigen oder – um es mit einem Gedicht Gomringers – visuell zu sagen:
schweigen schweigen schweigen
schweigen schweigen schweigen
schweigen schweigen
schweigen schweigen schweigen
schweigen schweigen schweigen
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke