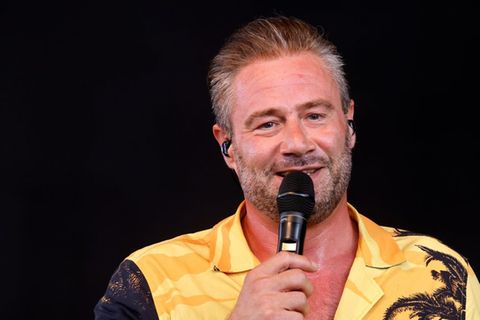Als „das letzte verbliebene Segment von WOKE“ beschimpfte Donald Trump gerade auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social die Smithonian Institution in Washington, DC: Die Einrichtung, die zahlreiche Museen betreibt, sei, schrieb er in der für ihn charakteristischen Großschreibung, „VÖLLIG AUSSER KONTROLLE GERATEN“. Was dort diskutiert werde, sei, „wie schrecklich unser Land ist, wie schlimm die Sklaverei war und wie wenig die Unterdrückten erreicht haben – nichts über Erfolg, nichts über Glanz, nichts über die Zukunft.“ Er habe deshalb seine Anwälte angewiesen, sich mit den Museen in Verbindung zu setzen und genau denselben Prozess einzuleiten, der bereits bei Hochschulen und Universitäten durchgeführt worden sei und dort zu enormen Fortschritten geführt habe, schrieb der US-Präsident.
Die Smithonian Institution war vorgewarnt: Gleich nach dem Amtsantritt der neuen Regierung im Frühjahr 2025 hieß es in einer offiziellen Erklärung des Weißen Hauses: „Donald Trump stellt Wahrheit und Vernunft in der Geschichte wieder her“. Das Smithsonian Museum in Washington, so weiter, „dient gegenüber der Welt als Symbol der amerikanischen Größe und macht Amerika stolz“. Der Vizepräsident, also J. D. Vance, habe den Auftrag, „unsachgemäße, spaltende und antiamerikanische Ideologie“ aus den Museen und Institutionen zu entfernen, die zum Smithsonian gehören.
Am 12. August 2025 wurde mit der Warnung Ernst gemacht. Lonnie G. Bunch III., der Chef des Smithsonian, erhielt einen Brief mit einem Ultimatum: Die Museumsleitung habe 120 Tage, um sicherzustellen, dass ihre Ausstellungen den Richtlinien des Präsidenten entsprechen. Es geht dabei um alles – die gezeigten Objekte, die Wandbeschriftungen, die Kataloge, die Künstler, die Texte auf offiziellen Webseiten. Insbesondere soll das Smithsonian dem Weißen Haus alle Materialien der Ausstellungen zugänglich machen, die zum bevorstehenden 250. Geburtstag der Vereinigten Staaten im nächsten Jahr geplant sind. Jeder Museumskurator, jeder Bedienstete des Smithsonian soll sich für Gespräche zur Verfügung halten. Außerdem muss dem Weißen Haus offengelegt werden, wer welche Stipendien erhält und woher Fördergelder stammen. Zunächst einmal sind acht Museen davon betroffen, unter ihnen die Museen für die Geschichte der schwarzen Amerikaner und der amerikanischen Ureinwohner, aber auch die staatliche Porträtgalerie und des Museum für allgemeine amerikanische Geschichte.
Laut dem Schreiben soll sichergestellt werden, dass sich das Smithsonian an die Direktive des Präsidenten hält, „die amerikanische Außergewöhnlichkeit zu feiern, spaltende oder parteiische Narrative zu entfernen und das Vertrauen in unsere gemeinsamen kulturellen Institutionen zu stärken“. Es soll eine Ideologie namens „Amerikanismus“ durchgesetzt werden; das Schreiben definiert sie durchaus vage als „die Menschen, Prinzipien und Fortschritte, die unsere Nation ausmachen“.
Transfrau als Freiheitsstatue
Das Smithsonian wird von einem „Board of Regents“ verwaltet, dem der Vizepräsident, der Oberste Richter, drei Senatoren, drei Kongressabgeordnete und neun Bürger angehören, die vom Kongress ernannt wurden. Das „Board of Regents“ operiert unabhängig von der Regierung; allerdings ist das Smithsonian in hohem Maß von Geldern der amerikanischen Bundesregierung abhängig. Der „Amerikanismus“ des Donald Trump soll von Angestellten des Museums in Zusammenarbeit mit Leuten von amerikanischen Bundesbehörden durchgesetzt werden; allerdings sagte das Weiße Haus nicht, welche Bundesbehörden involviert sein sollen.
Von amerikanischen Rechten wurden die Maßnahmen der Regierung mit Enthusiasmus begrüßt. Mike Gonzalez, der zur ultrakonservativen Heritage Foundation gehört, schrieb auf X: „Wenn man das Verhalten des Smithsonian in den vergangenen Jahren betrachtet, in denen alles Woke gefeiert, der Kommunistenführerin Angela Davies … viel Raum gegeben wurde, Amerika in einem schlechten Licht dargestellt wurde, kommt diese Untersuchung durch das Weiße Haus nicht eine Minute zu früh.“
Es gibt schon einen Vorgeschmack auf den „Amerikanismus“, der künftig das Smithsonian prägen soll. Anfang August entfernte das National Museum of American History die Hinweise auf die zwei Amtsenthebungsverfahren in Donald Trumps erster Amtszeit. (Die Beschriftungen über die Impeachments von Andrew Johnson, Richard Nixon, Bill Clinton blieben selbstverständlich erhalten.) Später durfte wieder auf Trumps Amtsenthebungsverfahren hingewiesen werden, allerdings nur in redigierter Form. Und im Juli sagte die schwarze Malerin Amy Sherald, die das offizielle Porträt von Michelle Obama geschaffen hat, eine Ausstellung in der National Porträt Gallery ab. Der Grund: Eines ihrer Bilder zeigte eine stolze Transfrau mit rot gefärbtem Haar als Freiheitsstatue, in deren Fackel gelbe Blumen blühen. Amy Sherald sollte dieses Bild aus der Ausstellung entfernen; dazu hatte sie keine Lust, also entfernte sie lieber ihre Ausstellung aus dem Museum.
Im Mai hatte Trump verkündet, er habe Kim Sajet gefeuert, die Direktorin der National Portrait Gallery. Sie stehe für „diversity, equity and inclusion“, also Vielfalt, Gleichberechtigung und Aufnahme anderer Menschen, und sei deswegen für ihren Posten „völlig ungeeignet“. Allerdings hat der Präsident gar nicht die Macht, Direktoren des Smithsonian zu entlassen. Kim Sajet zog es dann vor, aus freien Stücken zu gehen.
Der breitere Hintergrund, vor dem all dies betrachtet werden muss, ist folgender. Bis heute glauben viele Amerikaner, im Bürgerkrieg (1861-1865) sei es um die Rechte der Einzelstaaten gegangen; dabei betonten führende Politiker der Südstaaten von Anfang an in großer Offenheit, dass es ihnen um die Sklaverei ging. Noch 1990 wurde ein Dokumentarfilm von Ken Burns ausgestrahlt, in dem der Bürgerkrieg vor allem als schreckliche und sinnlose Tragödie erschien. Viel Zeit bekam dabei der Historiker Shelby Foote eingeräumt, nach dessen Meinung die Südstaaten damals einen Befreiungskrieg gegen die unterdrückerischen Nordstaaten führten. Noch immer ist unweit von Atlanta im Bundesstaat Georgia ein monumentales Relief zu besichtigen, das Jefferson Davis, den Präsidenten der rassistischen „Konföderierten Staaten von Amerika“, zusammen mit seinen Generälen Robert E. Lee und Stonewall Jackson zeigt. Wohlgemerkt: Es handelt sich hier um Aufständische, die gegen die verfassungsmäßige Ordnung der Vereinigten Staaten kämpften und einen Bürgerkrieg anzettelten, der vielleicht 750.000 Opfer forderte.
Andrew Jackson statt Harriet Tubman
Die „Reconstruction“ genannte elfjährige Periode, in der die Südstaaten von Unionstruppen besetzt waren, galt in amerikanischen Geschichtsbüchern bis vor Kurzem als fataler Irrweg, obwohl dies die einzige Zeit war, in der in den Südstaaten Schwarze in angemessener Zahl in den Länderparlamenten saßen. Auf den Zwanzig-Dollar-Noten prangt immer noch das Konterfei von Präsident Andrew Jackson, einem Sklavenhalter, der Gegner der Sklaverei als Bestien bezeichnete und den „Indian Removal Act“ von 1830 zu verantworten hat, durch den Zehntausende amerikanischer Ureinwohner, vor allem die Cherokee, in das Territorium westwärts des Mississippi vertrieben wurden. Tausende Frauen, Kinder und Alte fielen dieser „ethnischen Säuberung“ des 19. Jahrhunderts zum Opfer.
Donald Trump hat nie einen Zweifel daran gelassen, auf welcher Seite er in diesen geschichtspolitischen Auseinandersetzungen steht. Er nannte Andrew Jackson einen großartigen Präsidenten und spekulierte, dass der Bürgerkrieg hätte vermieden werden können, wenn Jackson – und nicht Abraham Lincoln – 1861 Präsident geworden wäre. In seiner ersten Amtszeit verhinderte er durch ein Machtwort, dass statt Jackson die schwarze Befreiungskämpferin Harriet Tubman auf den Zwanzig-Dollar-Scheinen abgebildet wird. Auch hat Trump sich wütend dagegen gewehrt, Denkmäler für die Helden der „Konföderierten“ zu schleifen. Die meisten von ihnen wurden ein halbes Jahrhundert nach dem Ende des Bürgerkriegs errichtet – und zwar vom Ku-Klux-Klan, der feierte, dass es ihm gelungen war, die weiße Herrenrasse im Süden der Vereinigten Staaten wieder an die Macht zu bringen.
Ein weiterer Bestandteil der Ideologie von Donald Trump ist die Feindschaft gegen Schwule, Lesben und Transsexuelle. In dieser Hinsicht sind Trump und seine Anhänger durchaus unoriginell: Aggressivität gegen sexuelle Minderheiten ist geradezu das Erkennungsmerkmal auch des russischen und ungarischen Regimes, um vom Iran zu schweigen. Ferner lässt sich unter Trump eine Feindlichkeit gegen Naturwissenschaften im Allgemeinen beobachten, die etwa in seinem Feldzug gegen amerikanische Universitäten zur Erscheinung kommt. Laut dem Magazin „Nature“ denken mittlerweile drei Viertel der amerikanischen Naturwissenschaftler darüber nach, die Vereinigten Staaten zu verlassen. Ob auch diese Wissenschaftsfeindlichkeit beim trumpistischen Umbau des Smithsonian eine Rolle spielen wird, bleibt abzuwarten.
Die Historikervereinigungen und der amerikanische PEN-Club haben sich angesichts des Briefes an Lonnie G. Bunch III. schon höchst alarmiert geäußert: Dies sei ein unzulässiger Eingriff in die Autonomie von Museen, ein Verstoß gegen das First Amendment, das Recht auf Meinungsfreiheit. Nur Fachleute, nicht Regierungsvertreter sollten darüber bestimmen, was in Museen gezeigt werde. Alles kommt nun auf das „Board of Regents“ an. Wird es vor Trumps Forderungen einknicken? Einerseits ist das Smithsonian auf das Geld der Bundesregierung angewiesen. Andererseits handelt es sich hier um das Geld der amerikanischen Steuerzahler. Und Donald Trump, dessen Umfragewerte seit seinem Amtsantritt in jeder Hinsicht zusammengebrochen sind, vertritt mit seinem Geschichtsbild die Meinung einer, wenn auch beachtlichen und sehr lauten, Minderheit.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke