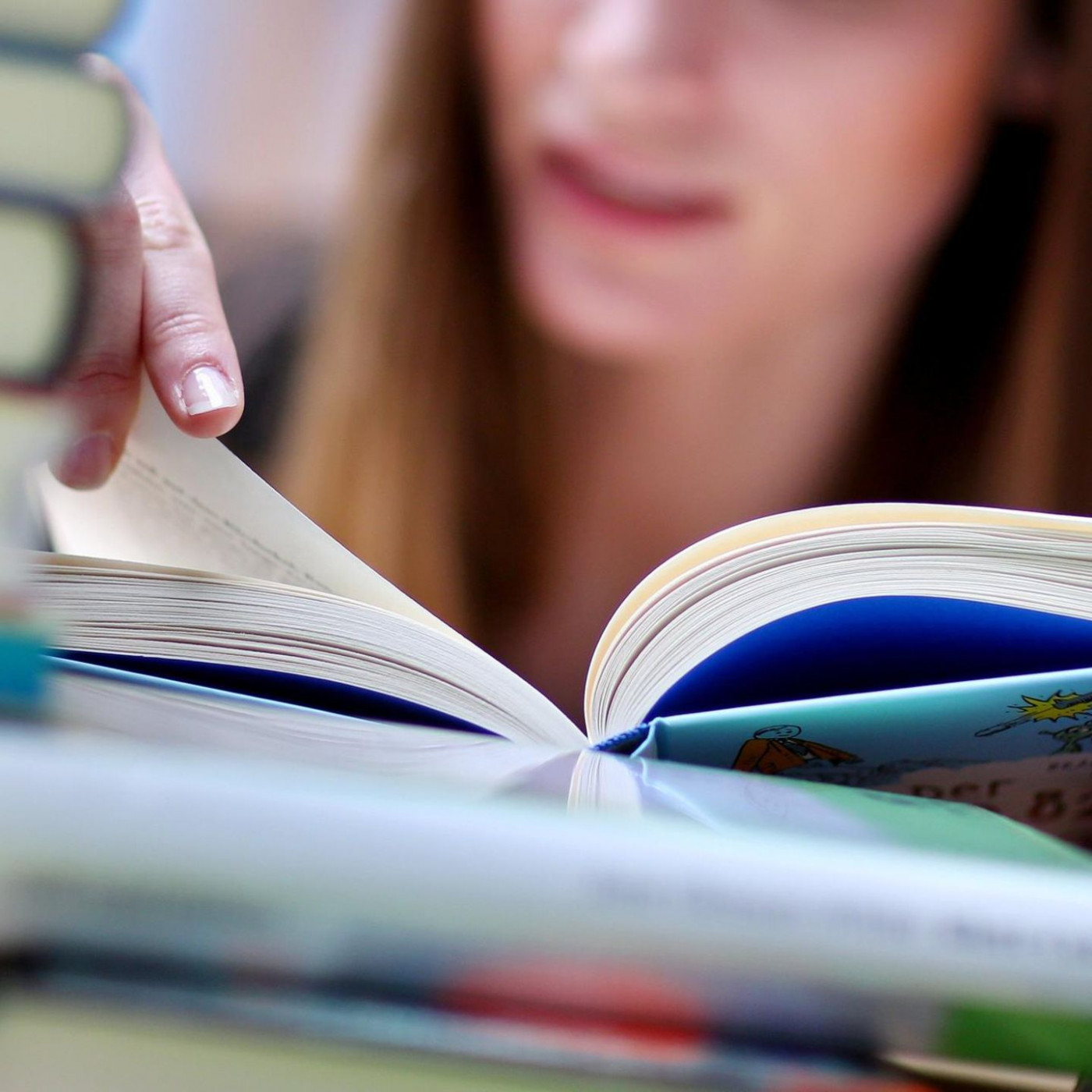Auch Literatur besteht aus Sätzen. Wenn man Haikus und Aphorismen ausnimmt, dann sind es sehr viel mehr als im Fitnessstudio, wo meist drei oder vier Sätze ausreichen, mit jeweils vielleicht zwölf oder 15 Wiederholungen einer Übung: Beinpresse, Kniebeuger, Butterfly, Latzug. Drei Sätze mal 15, das ist die goldene Formel für eine Anfängerin, zumal eine Frau Ende dreißig, die gerade Mutter geworden ist und zurückwill zu ihrem „Pre-Baby-Body“. Bitte nicht die Pausen vergessen: „Das war wichtig, dem Muskel zwischen den Sätzen Erholung zu gönnen, das gehörte dazu, das durfte man auf keinen Fall weglassen. Da war ich gewissenhaft, wirklich, das nahm ich ernst.“
Die Ich-Erzählerin von Verena Keßlers neuem Roman „Gym“ nimmt tatsächlich vieles ernst, sehr ernst. Nach einem Midlife-Bruch in ihrem bis dahin äußerlich höchst erfolgreichen Business-Leben, dem Verlust ihres Jobs und der Trennung von ihrem Freund, heuert sie trotz „Erdnussflipbauch“ als Thekenkraft im Fitnessstudio „MEGA GYM“ an.
Weil sie sich auf Dauer mit einer Nebenrolle nicht zufriedengeben kann, wird sie bald selbst zur Anhängerin – oder soll man sagen: zum Opfer des hier herrschenden Körperkults. Vom Zubereiten von Shakes namens „Sixpack on the Beach“ (Mango, Ananas, Maracuja, Wasser und Tropical-Flavour-Eiweißpulver, „es schmeckte wie Capri-Sonne mit Mehlschwitze“) wechselt sie auf Geheiß des Chefs Ferhat bald selbst an die Geräte und liefert „Sätze“ ab.
Irgendwann gibt sie, motivationsrhetorisch noch hinreichend trainiert aus ihrem früheren Karriereleben, selbst Fitnesskurse im Studio unter dem Namen „MOMpowerment“, die sich speziell an junge Mütter mit knappem Zeitbudget richten: „Aber ja, man kann auch im Gehen stillen. Man kann überall und in jeder Position stillen, wenn man nur will. In der Supermarktschlange, beim Kochen, Staubsaugen, Fensterputzen, auf dem Laufband, auf dem Crosstrainer – alles kein Problem.“
Ein Problem gibt es dann doch, nämlich dass die Powerfrau alles ernst nimmt außer die Wahrheit. Ihre Story beruhte auf der beim Vorstellungsgespräch mit Ferhat spontan erzählten Notlüge, ihr unsportlicher (und für den Job unvorteilhafter) Fitnesszustand sei die Folge ihrer Schwangerschaft. Die erste Schwindelei zieht weitere nach sich, harmlosen Fragen Ferhats und der Kolleginnen am Tresen werden mit immer abstruseren Erklärungen erledigt. Sie hantiert mit einer Milchpumpe, macht sich Flecken aufs Shirt, erfindet eine aufopferungsvolle Oma, die sich um den Jungen während der Arbeit kümmert.
Verwandlung zur Körpermaschine
Das ist alles noch der erste „Satz“, wie hier die Teile des schmalen Romans benannt sind. Verena Keßler hält sich selbst nicht an den Ratschlag, Pausen einzulegen, sondern joggt und jumpt in hohem Tempo durch die Handlung wie bei einem Textkörper-Power-Workout. Im zweiten Satz erfolgt dann die obsessive Verwandlung der äußerlich schlaffen Erzählerin zur Körpermaschine.
Das geht nicht allein mit Training. Die Ernährung wird radikal umgestellt, bis sie irgendwann fast nur noch Proteine zum Muskelaufbau zu sich nimmt. Dabei orientiert sie sich an einer preisgekrönten Bodybuilderin, die im gleichen Studio trainiert und die sie zu stalken beginnt: „Ich hatte nicht gewusst, dass Oberschenkel so aussehen konnten. Wo sich bei mir die Muskeln nur andeuteten, stand bei ihr jeder einzelne selbstbewusst für sich.“
Als sie schließlich zu Steroiden greift, ist es nicht mehr weit bis zur finalen Eskalation, bei der nicht nur das Lügengebäude zusammenbricht und klar wird, welche hässliche und blutige Sache sie hierhin geführt hat. Der unheimliche Wiederholungszwang, unter dem die Erzählerin steht, wird im Roman nur scheibchenweise offenbar. Man könnte von Salamitaktik sprechen, wenn Dauerwurst nicht das letzte wäre, was die Muskelfanatikerin zu sich nimmt.
Tatsächlich ist die – rein imaginäre – Rivalität zu der professionellen Athletin Folge einer tiefen Persönlichkeitsstörung. Die Aneignung der inneren und äußerlichen Merkmale einer anderen Person, der Zwang, sie erst nachahmen, dann übertreffen zu wollen, weisen auf einen gravierenden seelischen Mangel. Keßler legt nahe, dass unsere in Beruf wie Freizeit auf Konkurrenz ausgelegte Gesellschaft solche Störungen eher befördert oder jedenfalls deren (Selbst-)Erkenntnis verhindert.
Das „Gym“ ist so ein hochsymbolischer Ort, an dem die Orientierung an äußeren, von ästhetischen Idealen längst abgekoppelten Standards – Muskelumfang, „definierter“ Körper – zum Ventil potenziell krankhaften Ehrgeizes wird, ebenso wie die Karriere in der durchquantifizierten Arbeitswelt. Den beunruhigenden Schluss, dass auch die Literatur ein Feld für Wettkampf ist und das Romanvergleichen, bald wieder beim Deutschen Buchpreis zu erleben, der Individualität von Kunstwerken nicht gerecht wird, den zieht Keßler nicht. Doch ihr Roman legt nahe, dass das Gym nur ein besonders deutliches Modell ist für die allgegenwärtige Messbarkeit des Ichs.
Verena Keßler: Gym. Hanser Verlag. 192 Seiten, 23 Euro.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke