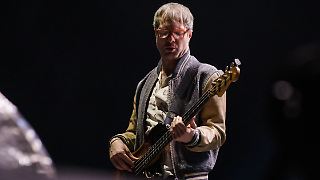Im kommenden Jahr feiern die Vereinigten Staaten von Amerika ein großes Jubiläum. Vor dann nämlich 250 Jahren wurde die Unabhängigkeit von Großbritannien erklärt. Für Präsident Donald Trump ist es Anlass, aktiv in die Erinnerung an die Geschichte der USA einzugreifen. Das historische Gedächtnis Amerikas wird in der Hauptstadt Washington maßgeblich von der Smithsonian Institution gepflegt.
Dazu gehören zwanzig Einrichtungen: Museen für bildende Kunst, für Natur- und Technikgeschichte, für die Geschichte des Landes und seiner Bevölkerung, Bibliotheken, wissenschaftliche Forschungseinrichtungen, sogar ein Zoo. Es ist ein Querschnitt der kulturellen und historischen Selbstvergewisserung der Vereinigten Staaten.
Nun hat die US-Regierung dem Smithsonian-Chef, Secretary Lonnie G. Bunch, einen Brief geschrieben. In dem vierseitigen Schreiben kündigt das Weiße Haus eine „interne Überprüfung“ aller Inhalte an – Ausstellungen, Objektbeschriftungen, Social-Media-Posts, sogar Mitarbeitergespräche stehen auf der Liste. Die Revision bedeutet nichts weniger, als dass sämtliche Aktivitäten der Smithsonian Institution auf ihre ideologische Tauglichkeit geprüft werden sollen. Ziel der Regierung sei es, eine „vereinende, historisch akkurate Darstellung“ der amerikanischen Geschichte sicherzustellen – und „spaltende“ Narrative zu entfernen.
Re-Formatierung der Geschichte
Verkleidet wird der Vorstoß Trumps in administrative Sprache. Man wolle lediglich herausfinden, ob die Museen „mit ihrer Mission übereinstimmen“. Doch es ist dieselbe Exekutive, die gegen Diversitätsprogramme vorgeht, Gendersprache verfolgt und sich gegen „negative Darstellungen amerikanischer Heldengeschichten“ wendet. Vor den 250-Jahr-Feiern der Vereinigten Staaten geht es weit darüber hinaus, nämlich um die Durchsetzung des Anspruchs, wie an die USA zu erinnern ist.
Das ist ein kulturpolitischer Dammbruch. Wenn die unterschiedlichen Perspektiven der historischen Forschung und Darstellung durch einen vom Weißen Haus diktierten inhaltlichen Standard ersetzt wird, dann ist das mehr als eine Verwaltungsvorgabe und mehr als ein zensorischer Eingriff – es ist der Versuch einer ideologischen Re-Formatierung der Geschichte.
Für diejenigen, die fürchten, dass die älteste Demokratie der Welt in den Faschismus abrutscht, ist der Angriff auf die bedeutendste staatliche Kulturorganisation der USA ein Alarmsignal mehr. Totalitäre Systeme aller Couleur, von den Diktaturen des 20. Jahrhunderts bis zu autoritären Regimen der Gegenwart, haben die Geschichtsschreibung stets als zentrales Herrschaftsinstrument verstanden.
In der Sowjetunion wurden historische Ausstellungen regelmäßig manipuliert und mit einer neuen historischen Erzählung versehen. In der Volksrepublik China kontrolliert der Staat bis heute, wie die kommunistische Revolution, Kolonialismus oder Kapitalismus visuell erzählt werden dürfen. Nazi-Deutschland hatte ganze Museumsbestände als „entartet“ diffamiert.
Ist der Regierungsvorstoß verfassungsgemäß?
So weit ist es in den USA noch nicht. Aber der Präsident reizt seine Exekutivbefugnisse stark aus, wenn er verlangt, dass die Smithsonian in den kommenden Monaten Entwürfe, Objekttexte, Personalstrukturen und geplante Ausstellungen vorlegen muss – womöglich ohne ausdrückliche gesetzliche Grundlage. Gerichte werden klären müssen, ob die Revision verfassungskonform ist.
Die zentrale Frage: Handelt es sich bei Museumsausstellungen um staatliche Meinungsäußerung oder um kuratorische Inhalte, die vom ersten Verfassungszusatz (freie Meinungsäußerung) geschützt sind? Werden historische Narrative angepasst oder gar zensiert, könnte dies als staatliche Einschüchterung oder Unterdrückung von Meinungsfreiheit gewertet werden.
Bevor Bundesrichter aber die verfassungsrechtliche Grauzone klären, kommt es nun auf die Direktoren, Kuratoren und Mitarbeiter der Smithsonian Institution an, ihre Häuser nicht zum Schauplatz einer rabiaten Symbolpolitik machen zu lassen, sondern als das öffentliche Gedächtnis einer offenen Gesellschaft zu verteidigen. Dabei sollten sie durchaus selbstkritisch sein und sich selbst einer Revision der bisherigen Ausstellungs- und Kommunikationspraxis unterziehen.
Die Smithsonian-Direktion hat inzwischen diplomatisch reagiert und ihre „Unabhängigkeit von parteipolitischen Einflüssen“ betont. Ob sie diesen Anspruch in den nächsten Monaten wird aufrechterhalten können, ist ungewiss. Die Leiterin der National Portrait Gallery Kim Sajet musste bereits vor einigen Wochen nach Angriffen von Regierungsseite ihren Hut nehmen. Ungewiss ist der Ausgang nicht zuletzt auch deshalb, weil das Smithsonian stark vom Kongresshaushalt abhängig ist und in seinem Aufsichtsrat – dem Board of Regents – auch Regierungsvertreter sitzen.
Kulturkampf um Amerikanismus
Dennoch: Jetzt kommt es auf Ungehorsam an – auf die mutige Anwendung jenes identitätsstiftend amerikanischen Leitprinzips, das von Henry David Thoreau als zivile Pflicht des Individuums in der Mitte des 19. Jahrhunderts geprägt wurde. Angesichts der kommenden Revision müssen sich die Mitarbeiter der Museen fragen, ob sie den Gehorsam verweigern können – oder womöglich müssen.
„Indem wir uns auf den Amerikanismus konzentrieren – die Menschen, Prinzipien und Fortschritte, die unsere Nation ausmachen“, so schließt der Brief des Weißen Hauses, „können wir gemeinsam daran arbeiten, die Rolle des Smithsonian als weltweit führende Museumseinrichtung zu erneuern.“ Diesen von Trump oktroyierten Kulturkampf – und hier ist der überstrapazierte Begriff wirklich angebracht – muss in den Institutionen angenommen werden, wollen sie der Rolle, die ihr die US-Regierung zugesteht, auch zum Jubiläum der unabhängigen Vereinigten Staaten noch gerecht werden.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke