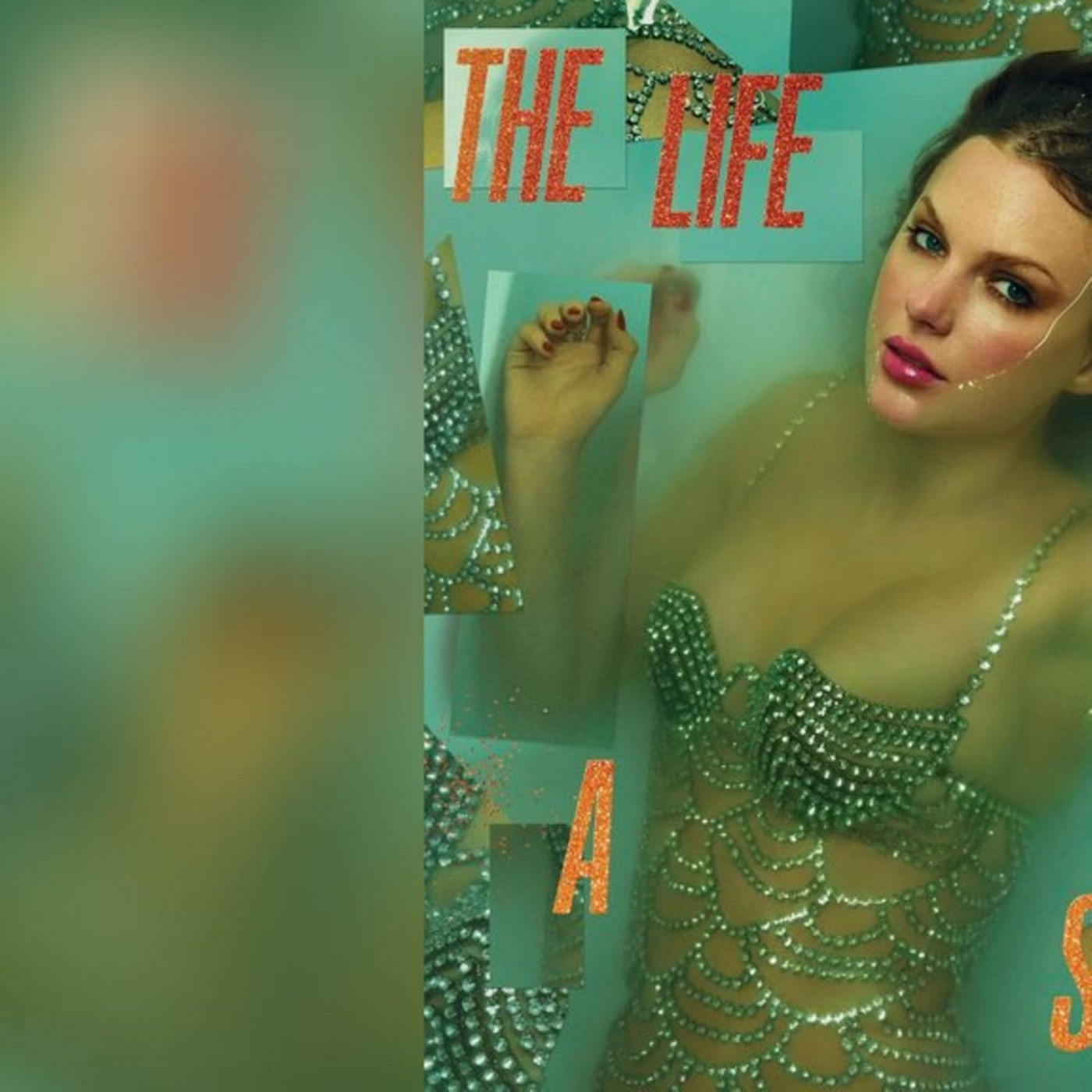Mit Wim Wenders wird ein Filmemacher 80 Jahre alt, der den deutschen Blick in die Welt getragen hat – und die Welt mit neuen Augen zurückblicken ließ. Seine Bilder erzählen vom Unterwegssein, vom Verschwinden und vom Fernweh. Wir gratulieren mit kleinen Liebeserklärungen an seine schönsten Filme – ein Streifzug durch verregnete Straßenschluchten, texanische Wüsten und verpasste Begegnungen.
Es war an einem grauen Januartag vor 40 Jahren, in einem schäbigen Kino in Mainz. Eine Epiphanie: Auf der Leinwand marschierte ein Mann mit roter Basecap unter einem irrsinnig blauen Himmel durch des Teufels Spielplatz – jenes leere, heiße Herz Amerikas, in das die Zivilisation seltsame Relikte gekegelt hat. Dazu klampfte eine Slidegitarre vier Töne. Ich war verloren in „Paris, Texas“, noch bevor der Film richtig begann – und blieb es. Verloren an Robby Müllers Farben, an Ry Cooders ausgezehrte Klänge, an die Geschichten unter den Bildern. An das Wunder, wie sich eine Peepshow in einen Beichtstuhl verwandelte und eine kleine Familienszene in ein existenzielles Erlösungsepos. Verloren ans Kino. Elmar Krekeler
Das Spätwerk „Perfect Days“ taucht ein in die alltäglichen Routinen eines Toilettenreinigers in Tokio, der Freude an seiner Arbeit hat, hinreißend dargestellt von der japanischen Schauspiellegende Kōji Yakusho. Die Klohäuschen aus dem Film – entworfen von Stararchitekten wie Shigeru Ban oder Kengo Kuma und ursprünglich errichtet als hygienische Vorzeigeobjekte für die Olympischen Spiele – haben sich zu Pilgerstätten für Besucher aus aller Welt entwickelt, die die Anlagen zum Teil systematisch abklappern, um sich davor zu fotografieren. Ein Beleg dafür, dass es Wim Wenders sogar gelingt, etwas so Triviales wie öffentliche Toiletten zu poetisieren. Heiko Zwirner
Fahren, fahren, fahren. Zuerst durch amerikanische Landschaften, dann durchs Ruhrgebiet, beide ähneln einander. Ein Journalist Anfang 30, dem Hören, Sehen und Schreiben vergangen ist, ein elfjähriges Mädchen, das ihm anvertraut wurde und mit dem er nach ihrer Großmutter sucht, die in Wuppertal leben soll. Das Geld geht zur Neige, das Mädchen hat Hunger, er liefert sie bei der Polizei ab und wird sie dennoch nicht los. Aber dann geschieht es: Alice, das erwachsenste Kind der deutschen Filmgeschichte, holt ihn aus seiner Verkapselung, sie muss dazu nichts anderes tun, als ihren Spezialtrick anzuwenden – Alice sein. „Alice in den Städten“ ist die langsame Heimkehr eines ans Erwachsensein Verlorenen, glücklicherweise noch nicht so vernagelt, als dass er sich nicht von einem Kind reparieren ließe. Ein Film, der aus vielen Gründen nicht mehr möglich wäre, was durchaus für den Film und gegen die Gegenwart spricht. Peter Praschl
Patricia Highsmiths berühmter Soziopath als Mephisto in Deutschland: Dennis Hopper, frisch vom „Apocalypse Now“-Set, spielt Tom Ripley als hohläugigen Dandy mit Cowboyhut. Er streift durch Europas Unterwelt wie durch eine Galerie schlecht ausgeleuchteter Bilder. Bruno Ganz bleibt als todgeweihter Rahmenbauer und Killer wider Willen zurückhaltend bis zur Selbstlöschung – ein Mann, der zu allem Ja sagt, außer zu sich selbst. Jan Küveler
Die Liebe ist eine Himmelsmacht, und dennoch sind gerade die Engel, die alle Gedanken lesen können, von ihr ausgeschlossen. Der von Bruno Ganz gespielte Damiel verliebt sich in eine Hochseilakrobatin mit Hühnerfederflügeln und beschließt, ein Normalsterblicher zu werden. Arthousiger kann ein Film kaum sein (Co-Autor Peter Handke). Zieht man den Kunstkitsch ab, bleibt eine fantastisch gefilmte Old-Boy-Meets-Girl-Geschichte aus dem geteilten Berlin, wo die schärfere Grenze zwischen Geist und Körper verläuft. Beim Nick-Cave-Konzert fallen schließlich alle Mauern. Richard Kämmerlings
1989, als wir noch nicht das Internet bewohnten, sprach Wim Wenders in „Aufzeichnungen zu Kleidern und Städten“ mit dem Designer Yohji Yamamoto über Mode, Identität und urbane Wahrnehmung. Der Film befragt den Stoffkünstler und spiegelt darin sein eigenes Handwerk: Wie Yamamoto „Wirkliches“ schneidert, fügt Wenders Zelluloid und Video zu experimentellen Kompositionen. Nie wirkte seine Suche nach dem gültigen Bild weiter entfernt – und nie näher. Cosima Lutz
Ein Deutscher will einen post-apokalyptischen Science-Fiction-Film drehen. Das Geld bleibt aus, Mitstreiter (darunter der legendäre Samuel Fuller als Kameramann) hauen ab. Zuletzt werden der Regisseur und sein US-Geldgeber erschossen. Wenders verarbeitete hier deprimierende Erfahrungen mit Hollywood. Heraus kam eine Reflexion übers Filmemachen, wie „8 ½“ von Fellini und „Die amerikanische Nacht“ von Truffaut – aber düsterer und schwarz-weiß. Matthias Heine
Manche Bilder vergisst man nie. In „Every Thing Will Be Fine“, der vor zehn Jahren mit James Franco und Charlotte Gainsbourg ins Kino kam, inszeniert Wim Wenders einen Autounfall, der erst im Nachhall zur Katastrophe wird. Ein Schriftsteller fährt ein Kind an – vermeintlich glimpflich. Doch erst die Frage nach dem Bruder enthüllt das Entsetzliche. Ein Film über das Trauma danach – still, verstörend, unvergesslich. Marie-Luise Goldmann
Das Kino hat diese neue Sprache namens 3D praktisch aufgegeben, außer James Cameron – und außer Wim Wenders, der ihre Möglichkeiten seit „Pina“ vor 15 Jahren in vier Filmen konsequent erforscht hat. Der Höhepunkt ist das Anselm-Kiefer-Porträt „Anselm – Das Rauschen der Zeit“, wo sich seine Kamera in die Kieferschen Räume regelrecht hineinfrisst, in seine Riesengemälde, Gewölbe, Türme. Es ist eine Überwältigung des Zuschauers, wie Kiefers Werke, und was wir sehen, spricht tiefere Bereiche unseres Gehirns an als das flache Normalbild. Hanns-Georg Rodek
Der Streit soll damit losgegangen sein, dass Wim Wenders den Film in Schwarz-Weiß drehen wollte. Es sollte schließlich ein Film noir über den Noir-Schriftsteller Dashiell Hammett werden. Produzent Francis Ford Coppola aber wollte Farbe auf der Leinwand. In dem Punkt hat sich der Geldgeber durchgesetzt. Wenders macht die genretypischen Punkte: abgehalfterter Hardboiled-Detektiv (mit dem Twist, dass er hier der Autor ist) schnüffelt sich durch mysteriöses Komplott. Für eine Hommage ist „Hammett“ zu wenig dark, für eine Persiflage leider nicht bunt genug. Marcus Woeller
In diesem Film – nach dem gleichnamigen Theaterstück von Peter Handke – passiert nichts. Doch, ein Paar unterhält sich über die Liebe. Im Garten eines Landhauses bei Paris. Sommerwind rauscht selten schöner im Kino als hier. Handke hat einen Cameo-Auftritt als Gärtner, Nick Cave spielt „Into My Arms“. Das Intro mit seinem Kameraschwenk über menschenleere Straßen von Paris nahm, ohne es zu wissen, das Lockdown-Lebensgefühl vorweg, vier Jahre vor Corona. Marc Reichwein
Als das Jahrhundert zu Ende ging, ersetzte Wim Wenders den Jugend- durch einen Alterskult. In „Buena Vista Social Club“ (1999) porträtierte er eine Greisenband um den 92-jährigen Compay Segundo, die gegen den Zeitgeist musizierte – und gerade deshalb zur ältesten Boygroup der Welt wurde. Die Kamera streifte über Falten und Fassaden, der Soundtrack kam von Ry Cooder, Wenders’ alter Seele aus „Paris, Texas“. Wer sonst sollte das 21. Jahrhundert besingen? Michael Pilz
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke