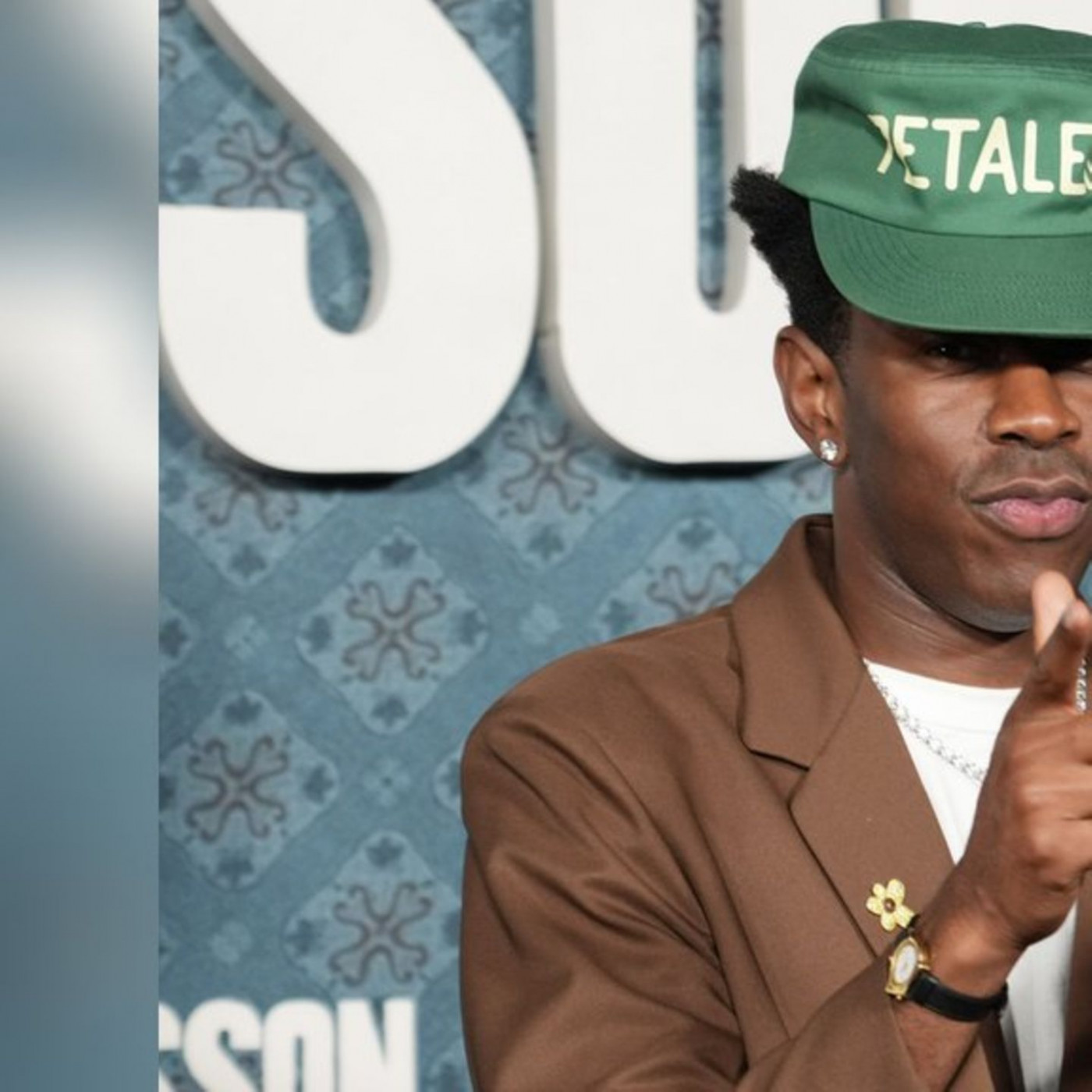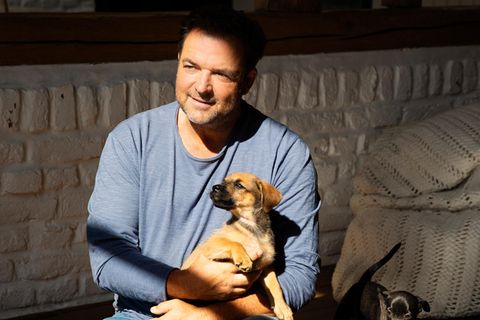Es gibt Künstlerinnen, bei denen man sich wünscht, sie hätten schon viel früher Sichtbarkeit erlangt und nicht erst mit 90 Jahren. Die aus Ronnenberg bei Hannover stammende Elisabeth Schrader ist so eine Künstlerin. Und doch hat die Qualität ihres Werks genau damit zu tun: Schrader arbeitete zeitlebens fröhlich am Kunstmarkt vorbei, strebte nie nach Beachtung und verschenkte ihre Arbeiten lieber als sie zu verkaufen. Ihre hoch akkurat gefertigten Federzeichnungen und ihre selbst gebauten, sauber umhäkelten Puppen und Alltagsgegenstände sind von einer so konzentrierten Dichte, dass die im Verborgenen ausgelebte Obsession und die Fantasie dieser Künstlerin zum Greifen nah erscheinen.
Erstmals vor größerem Publikum waren ihre Arbeiten in der von dem Berliner Kurator Frank Hauschild konzipierten Pop-up-Ausstellung zu sehen, die während des Gallery Weekend Berlin im Ami der Geheimtipp schlechthin war: handliche Puppenköpfe, geschmückte Torsi, kopfüber hängende Vögel, eine Ritterrüstung, ein lebensgroßes Diana-Kleid mit Pfeil und Bogen sowie eine giftig leuchtende Pilzlandschaft. Alle waren sie umhäkelt oder bestanden schlichtweg aus Elektrolitze: Die Künstlerin entdeckte den mit Kunststoff ummantelten Telefondraht vor dreißig Jahren zufällig in einem Elektroladen.
Das Material ist schwer zu bändigen, und man kann sich kaum vorstellen, wie eine ältere Dame derart viele und perfekt gestaltete, märchenhafte Formen konstruierte, ohne dass die Finger bluteten. Schrader fertigte daraus tiefschwarze, weißliche, rot gespickte und gelegentlich neongrüne Skulpturen an, bis sie nach zehn Jahren solche Schmerzen in den Händen bekam, dass sie davon abließ. Sie begann wieder zu zeichnen – damit hatte ihr Werk einst seinen Anfang genommen. In jener Pop-up-Schau erinnerte die minimalistische, surreal-geisterhafte Ausstrahlung ihrer Objekte an Werke von Louise Bourgeois und Rosemarie Trockel, aber auch an antike Büsten und Gewänder. Zugleich wurde klar, welch völlig eigenständige Bildsprache Schrader entwickelt hatte.
Elisabeth Schrader hat „Spaß dabei“
Wenn nun die Berliner Galerie Esther Schipper 38 Zeichnungen aus den Jahren 2005 bis 2013 präsentiert, so wird einmal mehr deutlich, wie ernsthaft und doch mit welch subtilem Humor Schrader bis ins hohe Alter arbeitete: Die Papierarbeiten in Schwarzweiß und Sepia sind von einer klaren, geometrisch durchmusterten Kompositionskraft. Sie erzählen von dem Horror vacui verloren wirkender Figuren in Zimmern, auf Plätzen und vor Industriearchitektur. Die Titel zeigen, welche Freude die Künstlerin an ihrer Arbeit hatte: Da sitzt etwa eine derangiert wirkende Hausfrau unter der Frisierhaube, die Putzutensilien im Hintergrund, und hat im Gegensatz zur Künstlerin offenbar nicht wirklich „Spaß dabei“.
Auf „Stumme Verehrung“ betet ein Kind einen muskulösen Bauarbeiter an, im Hintergrund eine Friedhofsmauer wie ein Menetekel. Eine „Frau mit Tiger“ hält dem Raubtier den Vorhang auf, die überbordenden Muster verleihen dem Bild etwas Orientalisches. Und ein Mann in Turnschuhen blickt auf „Kuhwerbung“ mit Schokolade. Man denkt an alte Kinderbücher oder an „Outsider Art“, ein bisschen auch an das bewusst naiv-illustrative Bildvokabular einer Dorothy Iannone, deren Figuren etwas Cartooneskes haben, aber auch Volkskunst heraufbeschwören. Zugleich zeigt sich an diesem über 60 Jahre lang getriebenen, intuitiv und sorgsam erarbeiteten Werk, dass Schrader keine dieser oft weiblichen Wieder- oder Neuentdeckungen ist, deren Arbeit manchmal zurecht vergessen war oder zum Lebensende hin nachlässt, wie es übrigens das Werk fast aller männlichen, supererfolgreichen Großkünstler tut. Schrader dagegen erfand sich immer wieder neu, ohne den Faden zu verlieren.
Gut möglich, dass sich diese Authentizität nur in den eigenen vier Wänden aufrechterhalten ließ. Denn obwohl sie die Kunst ihrer Zeit neugierig verfolgte, Ausstellungen vor allem in Hannover und Hildesheim besuchte, sich durch Kataloge von Eva Hesse, Maria Lassnig oder Camille Claudel inspirieren ließ und die Bücher von Virginia Woolf, Gertrude Stein und Simone de Beauvoir verschlang, hatte Schrader nie den Wunsch, Teil einer Szene zu sein. Genau diese Freiheit von Strategie, von der Sehnsucht nach Anerkennung und von dem Drang nach Aufmerksamkeit hat offenbar zu der Eigenständigkeit ihres Werks beigetragen, hinter dem sich auch eine deutsche Nachkriegsgeschichte verbirgt.
Geboren wurde Schrader 1935 als Elisabeth Salje in Barcelona als Kind deutscher Auswanderer. Ihre Eltern stammten aus Bayern und Hannover, sprachen Spanisch und Französisch. Als der Bürgerkrieg begann, zog die Familie 1936 nach Deutschland zurück und kam in einer kleinen Wohnung in Ronnenberg unter – der Ort, an dem Schrader fast ihr gesamtes Leben verbringen sollte. Mit zwanzig Jahren begann sie ein Kunststudium an der Hannoverschen Werkkunstschule, das sie an der Kunsthochschule Kassel bei dem abstrakten Maler Fritz Winter mit Staatsexamen abschloss. Sie wurde Oberstudienrätin, heiratete den Künstler Hinnerk Schrader und pausierte den Schuldienst von 1968 bis 1975, um sich um ihre drei Töchter zu kümmern.
In dieser Zeit entstanden die ersten Zeichnungen und Skulpturen aus Gips, Pappmaché und Ton sowie die ersten umhäkelten Puppen und Objekte, damals noch mit Garn und Bindfaden. Wichtig für sie, so hat die Künstlerin einmal erklärt, war ein Buch über ägyptische Kunst, das sie mit 17 Jahren in einem Antiquariat erwarb. Es mag als Erklärung dienen für die thronenden Tiere und geschmückten Köpfe, die immer wieder bei ihr vorkommen, auch in ihren Keramiken, deren Büsten, Tierköpfe und Sockel bemalt waren.
Doch vor allem mag Schrader von der rätselhaften Atmosphäre ägyptischer Kunst fasziniert gewesen sein, von deren mythologischer Ausrichtung auf ein Leben nach dem Tod, denn ihre Wesen wirken wie Gespenster, die auf merkwürdig selbstverständliche Weise ihren Platz im Raum behaupten. Als Schrader 1995 mit sechzig Jahren den Schuldienst vorzeitig quittierte – ihr Mann war sechs Jahre zuvor gestorben – stürzte sie sich in die eigene künstlerische Produktion.
Man kann in Schraders Kunst etwas Unheimliches, gar Düsteres sehen; Figuren, die einsam und unbehaust wirken, bedroht von ihrer eigenen Enge und geworfen in eine meist menschenleere Umgebung. Doch die Tochter der Künstlerin, die Schauspielerin und Regisseurin Maria Schrader, erklärt: „Meine Mutter liebte das, was sie tat und saß eigentlich ohne Unterlass daran. Und sie fand ihre Arbeiten oft sehr komisch!“
Maria Schrader bemüht sich gerade auf liebevolle, sensible Weise darum, dem Vorlass ihrer Mutter Präsenz zu verschaffen. „Auch wenn ich mich im Kunstmarkt nicht gut auskenne“, sagt sie im Gespräch mit WELT. „Die verschiedenen Werkgruppen entstanden aus der Lust meiner Mutter am Handwerk und den unterschiedlichen Materialien. Wenn sie arbeitete, gab es kein Zögern und nichts Falsches. Ein Blatt war fertig, das nächste wurde genommen, und es ging los.“
Es ist faszinierend, wie in dieser augenscheinlichen Konzentration eine so konsequente und doch unbedarfte Bildsprache von hoher emotionaler Intelligenz entstanden ist. Elisabeth Schrader orientierte sich nicht an Trends, Zeitgenossen und Vorbildern, nicht an philosophischen Theorien und feministischen Konzepten. Ihr Kompass war allein ihre innerste Begierde, zu schaffen und ihre – offenbar durchaus komplexe – Innenwelt in Kunst zu transformieren. Vielleicht, weil sie kein Erfolgsrezept entwickelte und sich kaum öffentlich behauptete, hat sich ihr Werk trotz seiner Wiedererkennbarkeit stetig neu gedreht und verändert, was als eines der größten Indizien für künstlerische Qualität überhaupt anzusehen ist.
In jüngster Zeit wurden ihre Zeichnungen erstaunlich abstrakt und farbenfroh. Sie malte mit Bunt- und Filzstiften, sodass eine starke, nie dagewesene Farbigkeit entstand – und doch ist die Abstraktion nur eine schlüssige Weiterführung der seriellen Muster, die ihre Figuren, Kleidungsstücke, Tiere, Plätze, Gebäude und Räume auf den Zeichnungen aufweisen, ebenso wie ihre Häkelobjekte ja ausschließlich aus Reihungen bestehen. Gut möglich, dass in diesen Wiederholungen etwas Beruhigendes lag – und dieser Wunsch nach Ruhe ein Grund war, weshalb Elisabeth Schrader ihre Heimat nie verließ. Dass diese Künstlerin ihren späten Erfolg noch erleben darf, ist so berührend wie ihre Kunst selbst.
„Elisabeth Schrader. Lieber woanders“, bis 30. August 2025, Galerie Esther Schipper, Berlin
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke