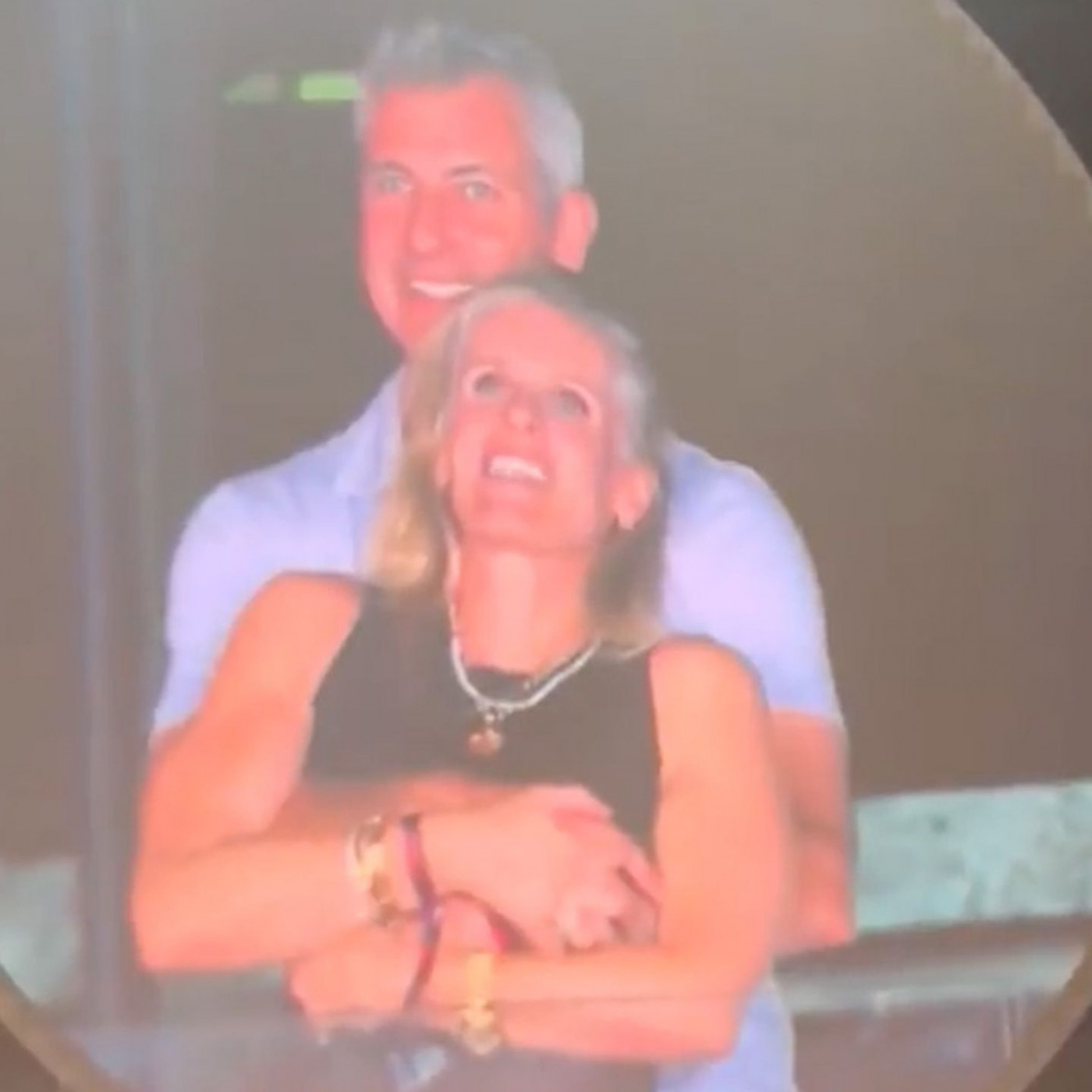Diese Oper muss man wollen. Sehr. Aber warum eigentlich? Ihr Komponist, der stets geschmack- wie gehaltvolle Gabriel Fauré, dessen 100. Todestag letztes Jahr bescheiden begangen wurde, gehörte nie zu den Vergessenen der Musikgeschichte. Er war zwar mit Schauspielmusiken erfahren, fühlte sich aber spät zum Musiktheater berufenen: Erst mit 68 Jahren gelang ihm ein Opernerstling, der sein einziger Beitrag zur Gattung bleiben sollte.
Mit dem Thema seiner dreiaktigen, nur etwas über zwei Stunden langen „Pénélope“ reihte sich Fauré ein in eine lange Reihe von Opern griechisch-antiken Inhalts. Ein Musikdrama über die Wiederbegegnung von Odysseus und seiner Frau nach zwanzig Jahren Krieg und Irrfahrt steht mit Monteverdis „Il ritorno d’Ulisse“ schon am Anfang der über 400-jährigen Operngeschichte.
Die „Pénélope“-Partitur erfordert ein normales Orchester der Zeit um 1913, die zwei Hauptpartien sind schwer, aber singbar, die Nebenrollen von jedem größeren Opernhaus samt Opernstudio besetzbar. Die Musik, nicht ganz so originell wie Debussys „Pelléas et Mélisande“, ist trotzdem von eigenwilliger Faktur, wellt sich fein, ist zart, schmiegsam und weich. Aber: Es passiert (fast) nichts. Hier ist das Warten Musik geworden. Es gibt Ausbrüche, aber kaum Dramatik. Und das Ende wirft mehr Fragen auf als es Antworten gibt.
Erst 2002 war die in Monte Carlo uraufgeführte „Pénélope“ in Chemnitz erstmals in Deutschland zu sehen; zuletzt gab es sie 2015 in Straßburg und 2019 in Frankfurt am Main. Jetzt hat sich die Bayerische Staatsoper als zweite Premiere der 150-jährigen Opernfestspiele im Münchner Prinzregententheater als passend amphitheatralischem Spielort mit all ihren reichen Mitteln für das Stück starkgemacht. Und es ist eine exemplarische Aufführung gelungen.
In „Pénélope“, so spröde ihre Inszenierung auch sein mag, gelingt ein einfühlsames Fin-du-Siècle-Frauenporträt. Obwohl die zurückgelassene, pflichtschuldige Gattin kein Symbolwesen ist, sondern beständig erklärt, rechtfertigt und von ihren Gefühlen erzählt. Das allerdings handlungsgerecht reduziert, sogar der gemeinsame Sohn Telemach wird unterschlagen. Penelope erhält ihren Mann wieder, der aber lässt sich Zeit mit seiner Enttarnung, man redet zielsicher aneinander vorbei. Er muss erst ein Gemetzel unter den auf sie, ihre Krone und ihr Reich lauernden Freiern veranstalten. Sie hingegen ist in der Einsamkeit vergilbt, die Liebe längst erloschen. Auch wenn jetzt in C-Dur ein Happy End beschworen wird.
In München inszeniert eine Frau, Andrea Breth, das aber analytisch böse und mitleidlos, mysteriös und doch erhellend. Und am Pult steht ebenfalls eine sehr gestaltungswillige Frau, die in der Moderne bewährte Finnin Susanna Mälkki, die sich die dankbare Partitur klanglich-konsequent erobert. Statisch, doch feinverästelt mäandert diese Musik, stark getragen von Faurés typisch holzbläsergetragenem Idiom. Mälkkis straffer Zugriff erlaubt kitschfreies Parfüm, beherzt gleiten die Klänge fluide voran; besonders schön spinnen sich die bukolischen Holzbläser-Melismen des Vorspiels zum zweiten Akt. Die Dirigentin ist immer sehr da, selbst wenn der sogar mit Leitmotiven spielende Komponist sich klein macht. So haben diese Musikstunden eine starke Präsenz und einen schönen Flow, auch und gerade in der nüchternen Inszenierung.
Raimund Orfeo Vogt hat Andrea Breth zunächst einen offenen Raum gebaut, eine Ruhmeshalle, in der meist kopflose Odysseus-Gipsabgüsse stehen. Und hinten, durch eine Wellblechtür, kommt dann auch der Antiheld mit grauem Bart, im weißen Anzug; erst lauernd, dann heldisch, immer sehr viril gesungen von Brandon Jovanovich. Doch nichts ist hier mit edler Einfalt, stiller Größe. Die trüb ausgeleuchtete Bühne verengt sich zu einer immer neuen, an der Rampe vorübergleitenden Abfolge klaustrophobischer Arbeitsräume, in denen ein surrealer Krimi wie in einem Magritte-Bild abzulaufen scheint. Emotionslos, doch höchst gespannt singen Mägde und Freier, gehen dabei seltsamen Beschäftigungen nach.
Das hohe Paar wird plötzlich gedoubelt, selten singen sie sich an, sind in verschiedenen Räumen, er auch mal im Rollstuhl, sie lethargisch am Boden liegend oder scheinbar tot auf einer Krankenliege. Die fantastische Viktoria Karkacheva macht in Faltenrock und Bluse optisch so gar nichts her, doch ihr Mezzosopran glüht von innen: Die Leidenschaft dieser bitter gewordenen Frau liegt ganz in ihrer Stimme. Aus dem Rest der vorzüglichen Besetzung ragen die mit erdigem Alt ungerührt in einer Zeitschrift blätternde Rinat Shaham als Amme Euykleia, der tenorwendige Loïc Félix als frechster der Freier und der baritonpastose Hirte von Thomas Mole hervor. Für dessen Auftritt macht Breth wieder die Szene frei, lässt sogar zwei putzige Schäfchen als Dekoration zu.
Am Ende, die Freier sind kunstblutfrei an Fleischerhaken entsorgt, eine mit den Füßen bogenschießende Artistin hat Odysseus bei seinem Sportstunt ersetzt, wird bestechend klar: Man hat hier zu lange gewartet, alle Gefühle sind tot. Es ist was faul auf der Insel Ithaka. Und während die Musik in konventionelles Zeus-Gejubel ausbricht, sitzt Penelope wie versteinert am Boden und hält Gottvater Odysseus ihren Finger wie in Michelangelos Sixtina-Fresko entgegen. Ob es hier aber noch mal zu einer Beseelung kommt? Unwahrscheinlich. Doch München hat bewiesen, dass man wenigstens „Pénélope“, die Oper, lieben kann.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke