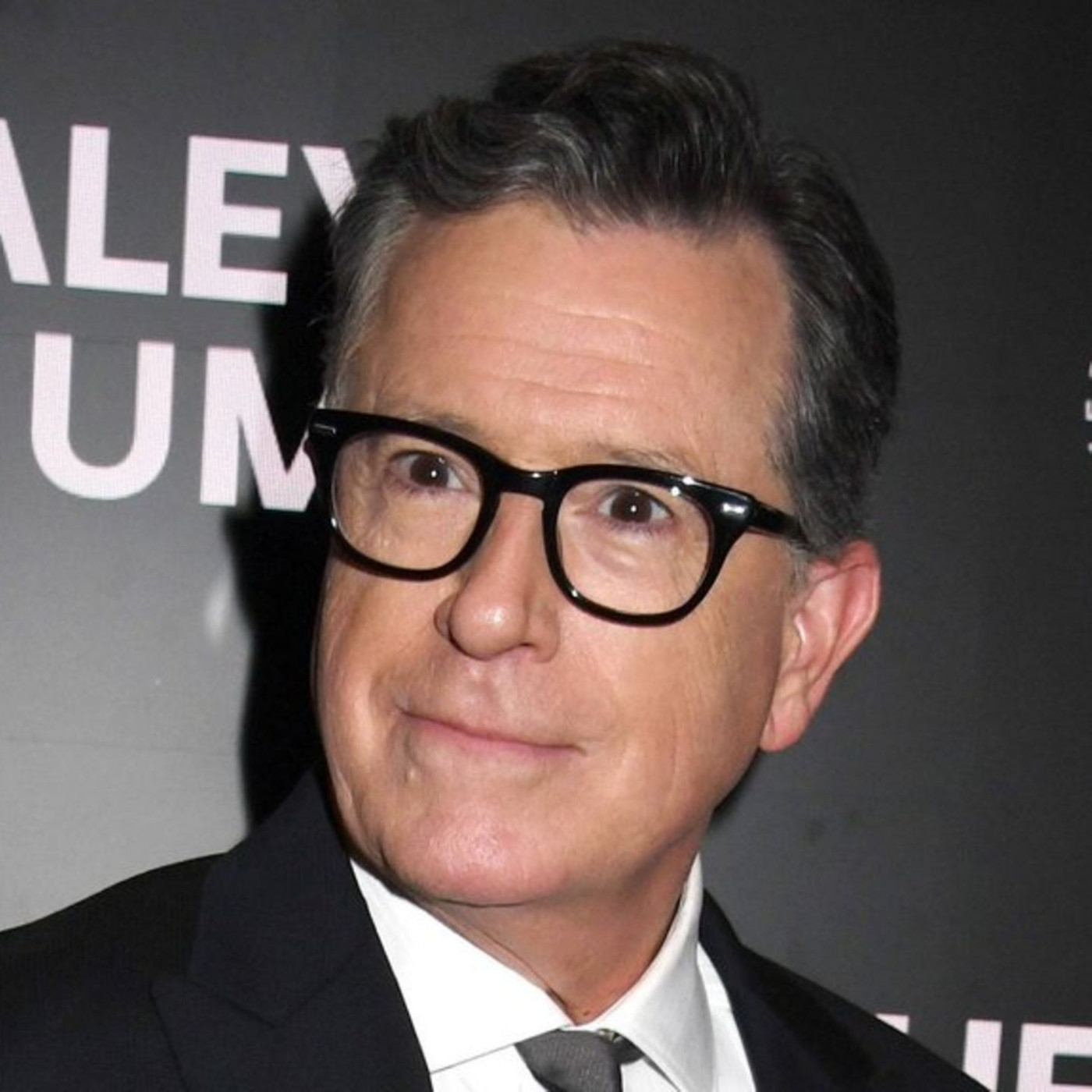Willa Knox hat von ihrer Tante ein Haus geerbt, in Vineland, New Jersey, einer Kleinstadt, in den 1870ern von einem Mann namens Charles K. Landis gegründet, der eine alkoholfreie utopische Kolonie errichten wollte. Es könnte ihre Rettung sein. Die Zeitschrift, für die sie geschrieben hat, wurde eingestellt, das College, an dem ihr Mann Iano unterrichtete, geschlossen, nun muss er sich mit einem schlechter bezahlten befristeten Lehrauftrag bescheiden, den er in der Nähe gefunden hat.
Ihr Schwiegervater Nick, Angehöriger einer Arbeiterklasse, die stolz sein durfte, ehe ihre Jobs in Biliglohnländer verlegt wurden, ist pflegebedürftig und medizinisch unterversorgt, weil die Krankenversicherung zickt, ihre Tochter Tig, erstklassiger Hochschulabschluss, dann vor dem Kapitalismus nach Kuba geflohen, ist mit gebrochenem Herzen wiedergekommen und schlägt sich als Köchin durch, ihr Sohn Zeke, Absolvent der Harvard Business School, ist Witwer geworden: Seine Frau, aus begüterteren Verhältnissen stammend, hat sich umgebracht und ihn mit einem Baby und mehr als 110.000 Dollar Schulden aus seinem Studienkredit zurückgelassen. Immerhin haben sie noch ein Dach über dem Kopf, denkt Willa. Dann sagt der Bauingenieur, mit dem sie über notwendige Renovierungen spricht, dass man es abreißen sollte: „Bei den tragenden Teilen, die ersetzt werden müssten, handelt es sich um alle. Tut mir leid. Sie haben kein Fundament.“
Ein Roman über die Mittelschicht
So geht es los in Barbara Kingsolvers Roman „Die Unbehausten“, und wer da, auf der allerersten von 619 Seiten, nicht ahnt, dass er für den Rest des Romans unablässig von Parabeln und Menetekeln belagert werden wird, traut der Literatur mehr Mysterien zu, als sie sich in harten Zeiten leisten kann. Der Roman Kingsolvers, im Original 2018 erschienen, handelt davon, dass der amerikanischen Mittelschicht der Boden unter den Füßen weggezogen wurde.
Kranke haben keine Krankenversicherung, hochbegabte junge Menschen schon zu Beginn ihrer Karriere irrwitzige Schulden, qualifizierte Stellen werden abgebaut, Mittfünfziger, die bisher halbwegs komfortabel durchs Leben kamen, haben Altersarmut vor sich und die Sicherheit, die erste Generation zu sein, deren Kindern es nicht besser gehen wird.
Kein Fundament mehr, nirgends, alles abreißen und neu aufbauen. Allerdings ist der Mann, der das verspricht, ein populistisches Großmaul, das gegen Migranten hetzt und die Gesellschaft spaltet. Und so wird in dem Jahr, in dem Donald Trump, der bei Kingsolver nur das „Megafon“ genannt wird, in den Wahlkampf um seine erste Präsidentschaft zieht, alles immer nur noch schlimmer. Ein Wirbelsturm reißt Löcher in Dach und Wände. Der alte Mann stirbt unversöhnt. Willas Plan, öffentliche Fördergelder aufzutreiben, weil ihr Haus ein historisch bedeutsames Gebäude sein könnte, erweist sich als Schimäre. Ihr Sohn kümmert sich nicht um sein Baby, weil er einen Investmentfond aufsetzen muss. Ihre Tochter findet sich mit der Prekarität ab, und Willa und ihr Mann müssen schließlich anderswohin ziehen. „A house is not a home“, hieß es in einem der schönsten Lieder Burt Bacharachs.
In Vineland sind es die gesellschaftlichen Verhältnisse, die es daran hindern, zu einem zu werden, seit jeher schon. In jedem zweiten Kapitel ihres Buches erzählt Kingsolver noch eine weitere Geschichte – über jenes Ehepaar, das einst an derselben Adresse wohnte und schließlich zerbrach, weil sie höhere Ansprüche hatte, als ihr Mann mit seinem Gehalt als Naturkundelehrer ihr erfüllen konnte, und weil er sich in seine Nachbarin verguckte, eine höchst unkonventionelle (und historisch verbürgte) Frau, die Spinnen beobachtete, Pflanzen katalogisierte und mit Charles Darwin korrespondierte.
Dennoch ist „Die Unbehausten“ kein Roman der Desillusionierung, sondern das genaue Gegenteil: das Porträt einer Frau, die sich nicht kleinkriegen lässt, sich unverdrossen Hurrikan-Folgen, Studentinnen, die es auf ihren Mann abgesehen haben könnten, Winterkälte, gelegentlichen Panikattacken, dem erzreaktionären Schwiegervater, der Bürokratie, ihrem hochtrabenden Sohn und ihrer apokalyptischen Tochter entgegenstemmt – eine Trümmerfrau, die den Schutt wegräumt, den ihr eine kollabierende Gesellschaftsordnung vor die Füße wirft. Man kann gar nicht anders, als sie zu mögen. Wie schafft sie es bloß, patenter zu sein als Uschi Glas, Veronica Ferres und Christina Neubauer zusammen?
Damit keine Missverständnisse aufkommen: Das ist schon in Ordnung. Die Allergien von Leuten, die Romane gerne subtiler und widersprüchlicher hätten, muss man Kingsolver ja ebenso wenig wie ihre Sympathien vorrechnen. Manchmal allerdings wird man ein wenig trotzig von so viel ausgestellter Tugend. Und ein wenig müde von einem Buch, in dem die Menschen oft aufeinander einreden wie in Talkshows („Quartalsweises Wachstum ist das Einzige, was Investoren interessiert. Der Drang nach Expansion ist der Motor der Wirtschaft. Das ist nun mal eine Tatsache“), aber kein einziger von ihnen sich entwickelt, weil stets schon feststeht, was sie denken, fühlen, sagen. Haltungen, so wertebasiert sie auch sind, sind möglicherweise nicht das Fundament, auf dem man Romane errichten sollte.
Barbara Kingsolver: Die Unbehausten. Aus dem Englischen von Dirk van Gunsteren. dtv, 619 Seiten, 26 Euro
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke