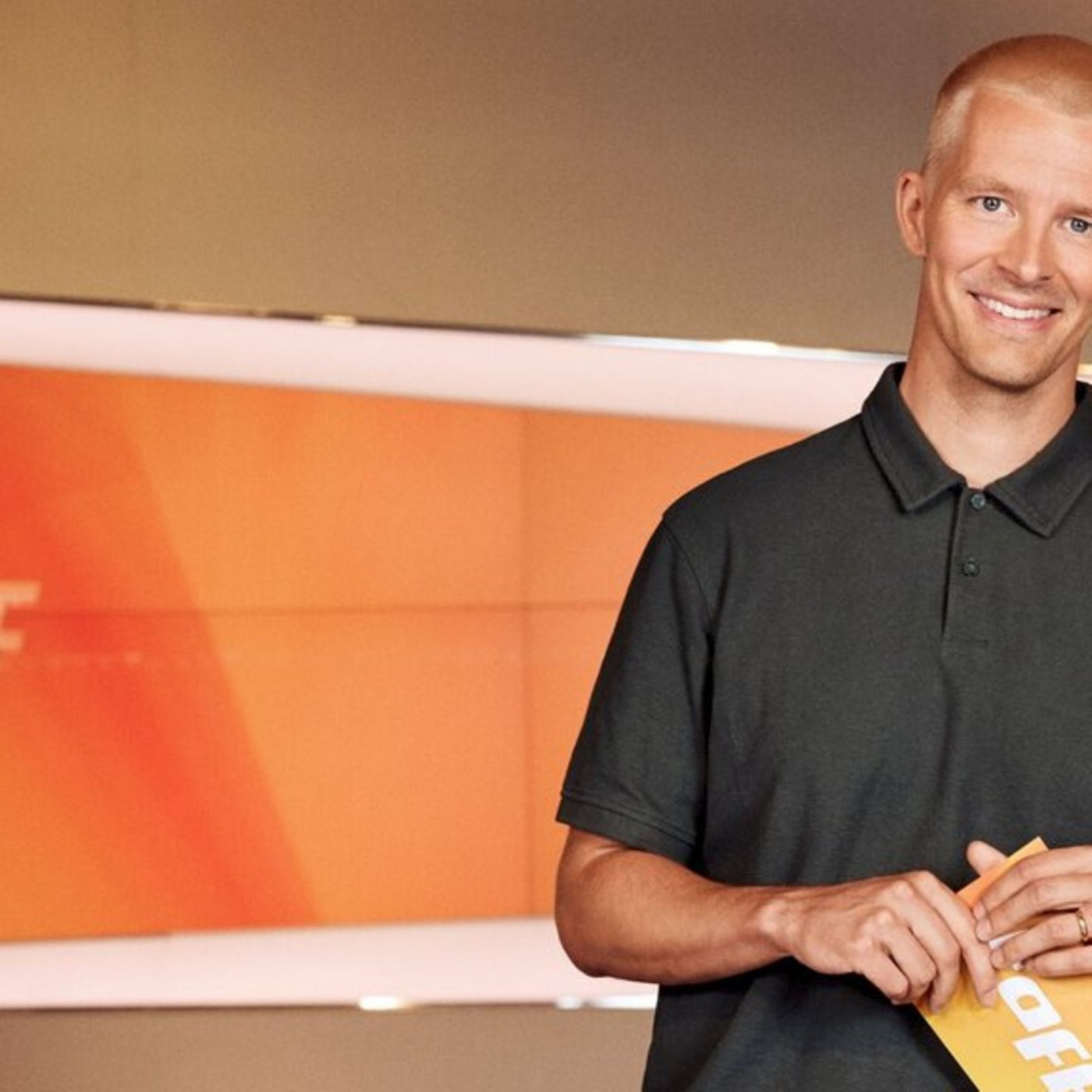Es heißt, der britische Maler William Turner habe sich an den Mast eines Segelboots seilen lassen, um von Wind und Wasser ausgepeitscht die Elemente zu spüren. Die sinnlichen Extremerfahrungen, die er in seine Gemälde übersetzte, machten ihn zum Vorläufer der abstrakten Malerei. Bei Mistral, wenn der kalte Wind aus dem Norden über die Côte d’Azur und das Mittelmeer jagt, darf man sich beim Übersetzen auf die Insel Porquerolles durchaus ein bisschen wie Turner fühlen.
Porquerolles, zwölf Quadratkilometer groß, ist eine der drei Inseln, die vor der südfranzösischen Stadt Hyères liegen. Hätte am Vortag nicht ein Unwetter an der Küste gewütet, könnte man denken, Charles Carmignac persönlich habe die bis zu 90 Kilometer starken Böen bei Boreas, dem Gott des Nordwindes bestellt, um die Besucher auf die Kunstausstellung „Vertigo“ einzustellen.
Der Direktor der Fondation Carmignac ist Sohn des Kunstsammlers, Finanzinvestors und Milliardärs Édouard Carmignac, er empfängt bereits am Festland am Hafen. Auch unbekannte Besucher begrüßt der 47-Jährige mit bise, mit dem gehauchten französischen Wangenkuss, weil hier alles etwas anders ist als in der grauen Normalität und selbst anders als im internationalen Kunstzirkus.
Bei „Vertigo“ bitte nicht an Hitchcock denken
Gäste der Stiftung werden mit einem Gebräu aus Lavendel, Melisse und Katzenminze empfangen, welches das parasympathische Nervensystem anregen und für Entspannung sorgen soll. Unter einer Allee von erhabenen Schirmpinien geht es zur Villa Carmignac – ursprünglich hatte ein französischer Industrieller das alte Bauernhaus in den 1980er-Jahren ausbauen lassen. Dank ihrer blau lasierten Dachziegel verschmilzt es mit der Landschaft.
Édouard Carmignac kaufte die Villa 2013 und hat sie in jahrelangen Bauarbeiten in ein teilweise unterirdisches Museum verwandelt, das trotzdem hell ist und Einblicke in die überbordende Natur gewährt. Die Stiftung feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Die Villa selbst wurde 2018 eröffnet und überlässt jedes Jahr einem „Kommissar“ die Konzeption einer thematischen Ausstellung. „Vertigo“, die achte seit der Eröffnung, ist der Abstraktion gewidmet und bietet eine pointierte Auswahl von ihren Anfängen bis heute.
Zum Besuch der Villa muss man die Schuhe ausziehen, seit je her. Das verschafft Bodenhaftung, verändert die Wahrnehmung. Keine Absätze klacken laut auf dem Steinboden. Und wer sich den Spaß macht, die Ausstellungsbesucher zu beobachten, der wird bei vielen spüren, wie Menschen ohne Schuhwerk etwas sehr Intimes preisgeben.
Wer bei „Vertigo“ aber an Hitchcock denkt, ist auf der falschen Fährte. Es geht nicht um Höhenangst, sondern um den Abschied von der Repräsentation, die Störung von Sehgewohnheiten. „Gemeint ist der Verlust der Orientierung, das Schwanken und Wanken“, erklärt Ausstellungskommissar Matthieu Poirier. Er hat etwa 50 Werke zusammengetragen, eine Handvoll aus der hauseigenen Sammlung.
„Vertigo“ beginnt mit einer Auftragsarbeit von Flora Moscovici, zu der man eine Treppe hinuntersteigt. Die Französin verwandelt gern Räume, die sie als zweite Haut bezeichnet, vom Fußboden bis zur Decke in begehbare Bilder. Auch dieses Mal hat sie in situ gearbeitet und sich von der Landschaft und den Farben der Mittelmeerinsel mit starken Blau-, Grün- und Lilatönen inspirieren lassen.
Moscovici hat ihre Pigmente kaum verdünnt und wie ein impressionistisches Gemälde über einen rechten Winkel aufgetragen. Der Titel ihrer Wandmalerei – „A la poursuite du rayon vert“ (Auf der Suche nach dem grünen Strahl) – ist eine Anspielung auf den gleichnamigen Roman von Jules Verne, in dem eine junge Schottin vor einer Zwangsheirat flieht und auf der Suche nach dem Naturphänomen in einer Grotte das absolute Glück findet.
Anspielend auf Goethes Konzept des Trüben hat Kurator Poirier noch andere Farbvirtuosen versammelt, die dem Blick jeglichen Anhaltspunkt verweigern: Ein Bild der amerikanischen Malerin Helen Frankenthaler, „Petroglyphs“, neben einem Gerhard Richter von 2009, gespiegelt von Frank Bowlings „Hello Rosa New York“, einem sieben Meter breiten und drei Meter hohen Gemälde, das Betrachter einlädt, sich in dem von zwei Flächen begrenzten Mittelfeld changierender Rosatöne zu verlieren.
„Es sind schwindelerregende Effekte, fast hypnotisch, psychedelisch, ganz ohne Drogen“, so Poirier, der offensichtlich schon mit den Titeln der Abschnitte das menschliche Gehirn ins Trudeln bringen will. „Atmosphärische Turbulenzen“, „Schwelle, Mirage, Abgrund“, „Malstrom“ sollen als Sehanleitungen gelten. Der Ausstellungsmacher ist zudem ein Bewunderer von Heinz Mack und schließt seine Schau mit einer passenden, ganz frühen Bleistiftzeichnung des mittlerweile 94 Jahre alten deutschen Künstlers. Das Blatt aus dem Jahr 1950 ist, wenn man so will, gegen den Uhrzeigersinn angelegt, beginnt in der Gegenwart, endet bei den Anfängen.
Auch Otto Pienes „Lichtballett mit Mönchengladbachwand“ ist in Carmignac aufgebaut, ein immersives Erlebnis, bei dem unterschiedliche Lichtquellen und kinetische Installationen die Wände zum Tanzen bringen. Mit Günther Ueckers „Spirale“ aus dem Jahr 2002 ist das Trio der Düsseldorfer Künstlerbewegung Zero komplett. Diese hatte sich nach dem Zweiten Weltkrieg auf die Fahnen geschrieben, die Kunst von ihrem „Übermaß an Ballast“ zu befreien. Die Stunde Null der Wahrnehmung hatte geschlagen.
„Subtraktion statt Addition“
Poirier hat noch andere Deutsche versammelt. Der Fotograf Thomas Ruff ließ sich von Aldous Huxleys Meskalin-Trips und seinem Buch „Die Pforten der Wahrnehmung“ inspirieren und bedruckte einen Kunstfaserteppich mit einem Muster, das bei jeder Möbelmesse als Erbrochenes durchgehen würde. Kommissar Poirier klärt auf, dass Ruffs „d.o.pe.05“ eine „visuelle Übersetzung des Prinzips der Fraktale ist, bei dem jede Einheit die Form des Ganzen hat, vergleichbar mit einer Schneeflocke oder einem Romanesco-Kohl“.
Die alten Meister der Abstraktion stehen im Dialog mit zeitgenössischen Arbeiten von Pier Stockholm, Fabienne Verdier, Caroline Corbasson, Philippe Decrauzat und Superstar Ólafur Elíasson. Beim Blick durch dessen Instrument aus buntem Glas, Spiegeln und Stahl verwandeln sich Garten und Meer in Gemälde von Klee, Klimt oder Kandinsky. „Your Vanishing“ ist der Titel des Werks von 2011.
Das 15 Hektar große Grundstück der Stiftung hat Frankreichs renommiertester Landschaftsarchitekt Louis Benech in einen zauberhaften „Nicht-Garten“ verwandelt, wie er es formuliert. Zwischen Lavendel, Ginster, seltenen Orchideen, eleganten Zypressen, Schirmpinien und Olivenbäumen stößt man auf zeitgenössische Kunstwerke. „Subtraktion statt Addition“ ist das Grundprinzip von Benech, dessen Paradieslandschaft Teil des Naturparks der Nachbarinsel Port-Cros ist. Das ist auch der Grund, warum Porquerolles vom Betonwahn verschont geblieben ist.
Für Touristen gibt es nur rund 500 Übernachtungsmöglichkeiten auf der Insel, die Zahl der Tagesgäste in der Hochsaison wurde nach den Masseninvasionen der Post-Pandemiezeit auf 6000 begrenzt. Wer sich einbildet, im August mit dem Auto auf der Halbinsel Giens bis zum Hafen zu gelangen und dann mit der Fähre übersetzen zu können, wird im Dauerstau eines Besseren belehrt. Der Besuch von Porquerolles will in der Hochsaison gut geplant sein. Aber wer es schafft, den wird der Schwindel der Schönheit den Kopf verdrehen.
„Vertigo“, bis zum 2. November 2025, Villa Carmignac, Île de Porquerolles, Frankreich
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke