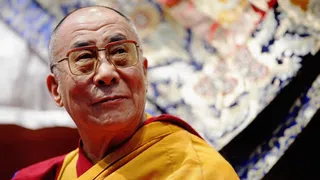Unglücklich das Land, das Helden nötig hat“, heißt es in Brechts Galilei-Drama. Lange konnten wir Europäer uns glücklich schätzen, weil der Bedarf an Heldentum, zumal militärischer Art, gedeckt schien, selbst in Nationen mit siegreichen Erinnerungen an Kriege wie den Briten, die ihre Helden stets besonders in Ehre hielten. Londons berühmtester Platz ist dem einst kultisch verehrten Sieger der Seeschlacht von Trafalgar gewidmet: Admiral Horatio Nelson.
In seinem Roman „Losing Nelson“ („Horatios Schatten“) gelingt Barry Unsworth das Kunststück, die urbritische Nelson-Obsession satirisch zu unterlaufen und dennoch von seinen grandiosen Leistungen so mitreißend zu erzählen, dass auch ein eher friedfertig gesonnener Leser die Schlachtverläufe atemlos verfolgt.
Von St. Vincent geht es nach Abukir und schließlich zur Apotheose von Trafalgar, bei der Nelson den Tod fand und damit endgültig zum Nationalhelden wurde. Zumal dort vor der spanischen Küste der Seemachtstatus des Vereinigten Königreichs auf Jahrzehnte zementiert wurde.
Der Nordengländer Barry Unsworth (1930–2012) gehörte wie John Fowles („Die Geliebte des französischen Leutnants“) zu einer Generation britischer Schriftsteller, die den historischen Roman als Mittel begriffen, die Nationalgeschichte postmodern und postkolonial zu befragen; auf diesem Weg folgten ihnen später Julian Barnes, Martin Amis, Graham Swift, Pat Barker und natürlich die großartige Hilary Mantel. Für „Das Sklavenschiff“ erhielt Unsworth 1992 den Booker-Preis.
„Horatios Schatten“ (1999) ist ein Gelehrtenroman, erzählt aus der Perspektive des autodidaktischen Nelson-Experten Charles Cleasby. Der einzelgängerische Kriegsmarine-Nerd hält sich selbst für einen Wiedergänger des Admirals, spielt im Keller auf dem Billardtisch zum Jahrestag die großen Schlachten nach und bastelt sein eigenes, denkbar unheroisches Leben zu einer Art Modellbauversion seines Vorbilds um.
Er schreibt eine Nelson-Biografie, wobei ihn seine lebenskluge (und heimlich angebetete) Sekretärin mit spitzfindigen Kommentaren zur Verzweiflung treibt: Ist die Rede vom Heldentum nicht zynisch angesichts der furchtbaren Realität des Sterbens der Mannschaften an Deck? Sind nicht alle Soldaten Mörder? Und Nelson nur ein besonders skrupelloser? Schließlich verliert Cleasby nicht nur sein vergöttertes Vorbild, sondern auch sich selbst.
Wenn die Royal Navy heute nach dem Willen der britischen Regierung mit dem Rückenwind der Zeitenwende wieder an vergangene Größe anknüpfen soll (unter anderem sollen bis zu zwölf neue, atomgetriebene Jagd-U-Boote angeschafft werden), dann werden auch die Denkmäler der großen Flottenführer wieder eines frischen Anstrichs bedürfen.
Heute segelt beziehungsweise taucht die Marine nicht mehr gegen Napoleons, sondern gegen Putins Großmachtträume. Taugt ein Nelson noch als Held für die Gegenwart, als Galionsfigur der europäischen Zeitenwende und Inbegriff einer vergessenen Tugend namens Tapferkeit?
Der Roman bleibt in dieser Frage ambivalent, denn bei aller moralischer Kritik am Mythos schimmert auch bei Unsworth der Glanz eines Heldentums durch, das wie die Nelson-Säule auf dem Trafalgar Square überlebensgroß ist.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke