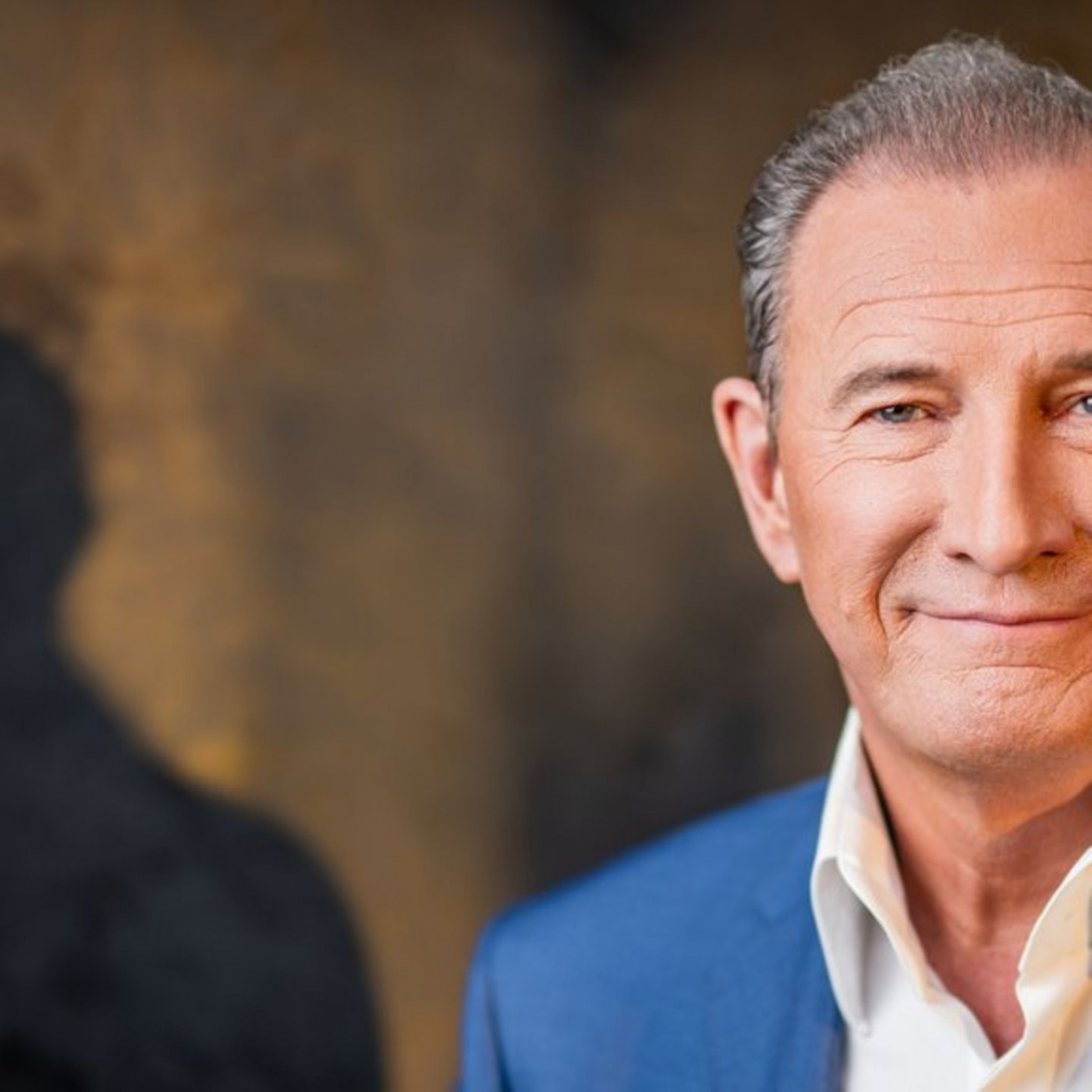Clärchens Ballhaus gibt es seit 1913, und es ist eins der sehr wenigen Ballhäuser aus dieser Zeit, die noch existieren. Ein wunderbarer Ort, der Kriege und Krisen, Mauerbau und Mauerfall und den Berlin-Mitte-Hype überlebt hat. Ein Bildband erzählt seine Geschichte - und noch sehr viel mehr.
Berlin ist - bei aller Liebe - keine besonders schöne Stadt. Und doch zieht sie seit Jahren, Jahrzehnten viele Menschen an - Touristen, Künstler, Zugezogene. Was Berlin so attraktiv, so speziell, so spannend macht, sind seine einzigartige Geschichte und seine besonderen Orte. Clärchens Ballhaus ist so ein besonderer Ort, auffallend mit seiner unsanierten Fassade in der sonst so schicken Auguststraße in Hipster-Mitte. Marion Kiesow ist mit ihrem Buch "Berlin tanzt in Clärchens Ballhaus" tief in seine Geschichte eingetaucht. Ein Buch? Ach was - ein Wälzer! Denn "Clärchen" gibt es bereits seit 1913 und so kommen entsprechend viele Geschichten und Geschichte zusammen.
Und Kiesow beleuchtet so ziemlich jeden denkbaren und auch undenkbaren Aspekt, der mit dieser Berliner Institution zusammenhängt: wer wann Besitzer und Betreiber war - von Clärchen und ihrem Mann angefangen bis heute. Wer dort gearbeitet hat - vom Garderobier über den Einlasser, die Eintänzer, Kellner und Bardamen bis zur Klofrau. Wer dort zu Gast war - vom einfachen Arbeiter bis zum Weltstar und Prinzen. Auf welchen Stühlen man bei Clärchen saß. Welche Tanzstile wann modern waren (und welche wann verboten), welche Getränke man trank, welche Zigaretten man rauchte, welche Kleidung man trug ... Und auch, wie die Politik und die geschichtlichen Ereignisse draußen vor den Ballhaustüren das Geschehen drinnen beeinflusst haben.
Durch Krisen, Kriege und Mangelwirtschaft
Denn Clara und ihr Mann, später ihre Erben, mussten sich allerhand einfallen lassen, um durch die Jahrzehnte zu kommen - durch zwei Weltkriege, Wirtschaftskrisen und die Nazizeit, durch die Mangeljahre nach dem Krieg und die Mangelwirtschaft in der DDR, Mauerbau und Mauerfall und die großen Veränderungen, die damit einhergingen. Und es war vor allem Clara, die das Ballhaus von 1928 bis 1967 leitete (und 1971 starb), die großen Erfindungsreichtum und Improvisationstalent bewies, um auch schlechte Zeiten zu überstehen. Ebenso Tochter Elfriede Wolff, die von 1969 bis 1989 Chefin war.
Da waren etwa die "Witwenbälle" (ohne Witwen), die Clara sich einfallen ließ, als zu Kriegszeiten und danach die männlichen Tanzpartner fehlten. Die Kaffeekränzchen für Damen, annonciert als "Tugendrose", oder die Vermietung des Spiegelsaals im oberen Stockwerk an schlagende Studentenschaften, die sich dort im Mensurfechten übten (was verboten war), als das tanzende Publikum ausblieb. Die vom deutschen Militär nach Ende des Zweiten Weltkriegs massenhaft zurückgelassenen Landkarten, deren Rückseite bis in die 60er Jahre als Ersatz-Tischdecken oder zerschnitten als Notiz- und Abrechnungszettel dienten. Oder auch die Tatsache, dass die Ballhaus-Musiker, als Swing in der NS-Zeit als "undeutsch" verboten, aber dennoch beliebt war, ihn trotzdem spielten. Auf den Notenblättern stand dann einfach Foxtrott drauf, falls mal Kontrolle kam.
Und wenn zu DDR-Zeiten wieder mal neue Gläser gebraucht oder die Getränke knapp wurden - private Gaststätten wie Clärchens Ballhaus wurden bei der Warenzuteilung knapper bedacht als staatlich geführte - fuhr die Chefin eben selbst mit dem Auto zu den Herstellerbetrieben, besorgte das Gebrauchte auch mal mit ein bisschen Schummeln und lud den Wagen voll, bis er fast zusammenbrach. So ist "Berlin tanzt in Clärchens Ballhaus" auch die Geschichte hart arbeitender Frauen, die die Hosen an und das Zepter in der Hand hatten.
"Von ihrem Gatten tatkräftig unterstützt"
Das beginnt schon beim Namen - denn anfangs hieß das Etablissement eigentlich "Bühlers Ballhaus", nach Claras erstem Ehemann Fritz Bühler. Doch man ging eben "zu Clärchen", so stand es ab Ende der 1920er auch zusätzlich als Leuchtreklame am Haus, in Annoncen und der Firmenadresse, ab 1970 schließlich verschwand der Bühler ganz. Und schon 1938 schrieb eine Berliner Tageszeitung, aus der das Buch zitiert: "Geleitet wird das Ballhaus von der rührigen Frau Arthur Habermann, die von ihrem Gatten tatkräftig unterstützt wird." Aus heutiger Sicht irritierend, dass sie unter dem Namen ihres zweiten Mannes aufgeführt wird und nicht unter ihrem eigenen, aber dennoch wird klar: Sie ist eindeutig die Chefin! Die das Haus, wie ebenso später Habermanns Tochter Elfriede Wolff, mit "preußischer Disziplin" führte.
Und die war offenbar nötig, denn man darf nicht vergessen: So ein Ballhaus ist ein Amüsierbetrieb, es fließt reichlich Alkohol, Mann und Frau kommen sich beim Tanzen näher - und nicht immer sind sie miteinander verheiratet. Viele Affären, Liebschaften und Romanzen begannen hier und auch Prostitution gab es durchaus, vor allem zu DDR-Zeiten, mit dem Ziel Westgeld - aber ohne Wissen der Geschäftsleitung, heißt es im Buch. Und Clärchens Ballhaus war nie was für feine Leute, eher für "das einfache Volk", für den Fleischermeister und das "Frollein". Bezahlbar, ein Ort, wo man nach der Arbeit hinging, ein "Ballhaus für das solide Vergnügen der kleinen Leute". Über all die Jahrzehnte, bis zur DDR-Zeit, wo sich die einheimische Bevölkerung mit West-Touristen mischte, vor allem aus Westberlin, genau beäugt von der Stasi, die auch die Vorgänge bei Clärchen im Blick hatte.
Erst kurz vor dem Aus, dann Kult
Nach dem Mauerfall hatte es Clärchens Ballhaus erst schwer - das angestammte Ost-Publikum schaute sich erst mal im Westen um, die neuen DM-Preise konnten sich nicht alle leisten, die Gästezahl wurde kleiner und kleiner.
2005 dann ein großer Umbruch - der Ballhaus-Erbe hatte das Haus verkauft und der Betreiberfamilie Wolff komplett gekündigt. Das Aus für Clärchen stand drohend im Raum, doch dann: neue Betreiber, neues Konzept. Es gab plötzlich Pizza, DJs legten auf, eine Mischung aus Schlagern und Popmusik - und die Jugend kam! Die Alten aber auch. Das Ballhaus wurde (wieder) Kult und rammelvoll. Sogar das alte Personal kehrte teilweise zurück. 2009 drehte Quentin Tarantino hier Szenen für "Inglourious Basterds" und 2017 waren der britische Prinz William und seine Frau Kate während ihres Deutschland-Besuchs bei Clärchen.
Und heute? Clärchens Ballhaus gibt es noch - ein bisschen wie früher, aber doch ganz anders. Investor Yoram Roth hatte es 2018 übernommen mit dem Versprechen, es solle so "cool" bleiben, wie es schon immer gewesen sei. Er habe es "gekauft mit dem klaren Ziel, 'Clärchens Ballhaus' zu beschützen. Es ist auch für mich ein wichtiger Ort", sagte Roth im Sommer 2019. Er kündigte den Pächtern, das Ballhaus wurde geschlossen, renoviert und 2024 wieder eröffnet.
Unten essen, oben tanzen
Und er hat sein Versprechen gehalten - bei allen Veränderungen: Unten ist nur noch ein Restaurant ohne Tanzfläche; es heißt "Luna D'Oro" und wurde vom Szenenbildner der bekannten Serie "Babylon Berlin" sehr gelungen im Stil der 1920er Jahre gestaltet.
Doch der Spiegelsaal oben sieht aus wie eh und je - mit abblätterndem Putz, Wasserschäden und fleckigen Spiegeln, die schon viel gesehen haben. Hier wird noch geschwooft, es gibt Tanzkurse und andere Veranstaltungen wie den (immer ausverkauften) Pop-up-Chor "Yeschoir".
Er lebt also noch und hat eine (hoffentlich lange) Zukunft, dieser besondere Ort, dem Marion Kiesow mit ihrem Buch ein Denkmal setzt und eine Liebeserklärung macht. "Berlin tanzt in Clärchens Ballhaus" besitzt einen sehr lebendigen Charme durch die vielen persönlichen Stimmen der Zeitzeugen, der Gäste und Mitarbeiter, durch unzählige private Fotos und Originaldokumente wie Speisekarten, Zeitungsartikel, Rechnungen und Briefe.
Die Autorin hat offenbar in alle Richtungen recherchiert und konnte sich nicht von all ihren Entdeckungen trennen - so ist auch eher Abseitiges im Buch, und vor allem gegen Ende wirken manche Kapitel etwas rangehängt nach dem Motto: Ach, das muss auch noch mit rein! Auch ein etwas penibleres Lektorat hätte dem dicken Wälzer gutgetan. Dennoch: Er ist ein großes Lesevergnügen, was fürs Auge und macht garantiert Lust auf einen Besuch. Denn "nicht umsonst sagt man: Wer nicht bei Clärchen war, der war nicht in Berlin!"
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke